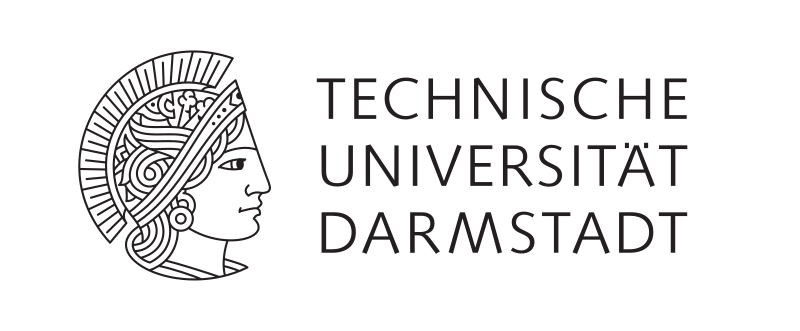Determinanten
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Formal Metadata
| Title |
| |
| Title of Series | ||
| Part Number | 22 | |
| Number of Parts | 29 | |
| Author | ||
| License | CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 Germany: You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this | |
| Identifiers | 10.5446/33609 (DOI) | |
| Publisher | ||
| Release Date | ||
| Language |
Content Metadata
| Subject Area | |
| Genre |
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
00:00
SequenceLie groupSystem of linear equationsMaß <Mathematik>MathematicsMatrix (mathematics)Set (mathematics)Numerical analysisCalculationTheory of relativityTransformation (genetics)Euclidean vectorZahlGroup theorySet theoryPhysical quantityLinieModel theoryRaum <Mathematik>Product (business)Matrix (mathematics)Matrix (mathematics)ModulformEquationSquareCombinatory logicCategory of beingVector spaceTriangleWell-formed formulaDimensional analysisIntegerRecursionDecision theoryDeterminantOrthogonalityInequality (mathematics)Energy levelAbbildung <Physik>Equivalence relationÄquivalenzrelationAnalytic continuationArithmetic meanPropositional formulaAxiom of choiceGrothendieck's relative point of viewProof theoryDivision (mathematics)3 (number)Plane (geometry)Connected spaceForcing (mathematics)Sheaf (mathematics)Line (geometry)Group actionContent (media)Coordinate systemPower (physics)Linear mapRepresentation theoryLinear regressionMaterialization (paranormal)MereologyMoment (mathematics)MultiplicationPhysical systemProjective planeElementary arithmeticMilitary rankRankingResultantHexagon7 (number)Scalar fieldDot productSampling (statistics)Standard errorMilitary baseTerm (mathematics)NumberRecursive languageAreaSummationLinearizationGoodness of fitVector graphicsDivisorÄhnlichkeitstransformationSimilarity (geometry)MeasurementLength of stayBasis <Mathematik>Parameter (computer programming)MassNormal (geometry)Connectivity (graph theory)Heegaard splittingBasis (linear algebra)Square numberSummierbarkeitAdditionPoint (geometry)Absolute valueKörper <Algebra>Social classSpecial unitary groupPoisson-KlammerSequelCircleRoundness (object)NullSpezielle orthogonale GruppeCoefficientDirection (geometry)Acoustic shadowLinear independenceDreiecksmatrixProcess (computing)Lattice (order)ExpressionRechenfehlerInvertierbare MatrixRound-off errorDiagonalGreatest element9 (number)Sign (mathematics)Alpha (investment)LTEIdentical particlesCondition numberReflexive spaceOrthonormal basisDifferent (Kate Ryan album)CalculationDarstellungsmatrixElement (mathematics)Multiplication signRule of inferenceStandard deviationSolution set2 (number)Inverse elementSpacetimeRight angleGAUSS (software)Group representationPosition operatorConcentricFeld <Mathematik>Musical ensembleMoving averageComputer animation
Transcript: German(auto-generated)
00:01
Präsentiert von OpenLearnWare, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. Gut, dann wünsche ich Ihnen mal einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Fortsetzung vom Frommen und Nutzen des Basiswechsels. Ich hatte Ihnen letztes Mal gezeigt, irgendeine wilde lineare Abbildung gegeben
00:26
und dann habe ich Ihnen aus dem Hut gezaubert die richtige Basis hingeschrieben. Dann haben wir den Basiswechsel durchgerechnet und festgestellt, auf die Weise können wir die Abbildungsmatrix, wenn es gut läuft, schön vereinfachen. Und was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist ein bisschen das Umgekehrte.
00:45
Und das passt zu der Fragestellung, die ich auch schon ein paar Mal erwähnt hatte. Gegeben, konkret, geometrisch eine lineare Abbildung, wo kriege ich die Abbildungsmatrix her? Also das ist das Beispiel 95. Und da wollen wir, haben wir eine Ebene und eine Richtung und suchen die Projektion in die Richtung auf die Ebene.
01:09
Also wir suchen die lineare Abbildung Phi vom Anschauungsraum R3 in den Anschauungsraum R3. Und das soll die Projektion sein auf einen Untervektorraum, der gegeben ist durch die lineare Hülle von zwei Vektoren.
01:25
Also so eine Ebene, die durch den Ursprung geht, Vektor 011 und Vektor 121. Das ist die Ebene durch Null, die von diesen beiden Vektoren aufgespannt wird. Und auf die will ich den ganzen Raum projizieren. Jetzt muss ich noch sagen, wo die Sonne steht.
01:43
Also in welche Richtung ich projizieren will. Und die Richtung gebe ich an durch eine Gerade, die durch den Ursprung geht und die wird aufgespannt von einem Vektor minus 4, minus 1, 2. So die Situation ist die hier auf dem Bild. Sie haben eine Ebene und Sie haben die Gerade, die die Richtung angibt.
02:04
Also stellen Sie sich vor, die Ebene ist der Boden oder eine Wand, irgendwas. Und die Gerade gibt die Richtung an, in der die Sonne steht und Sie sollen den Schattenwurf berechnen. Das ist das, was die Projektion macht. Also Schattenwurf von jedem Punkt im Raum auf diese Ebene. Zugegebenermaßen ist es ein bisschen seltsam, weil Sie brauchen zwei Sonnen, eine oben und eine unten.
02:22
Ja, aber natürlich auch die Punkte von unten auf die Ebene projiziert werden sollen. Ja, aber wir können uns das hoffentlich vorstellen, also Sie haben oben eine Sonne und unten eine Sonne und beide machen hier einen Schattenwurf. So, also erstens sorry für die lausige Qualität, das ist ein ziemliches Notding gewesen.
02:41
Das Bild ist erst sehr kurzfristig entstanden. Aber ein Punkt ist bewusst, Sie sehen, ich habe Ihnen hier diese Ebene und diese Gerade hingeklatscht und da ist überhaupt kein Koordinatensystem. Das ist nicht weil zu wenig Zeit, sondern das ist so gewollt, weil ich irgendwie Augenmerk darauf lenken will.
03:00
Also wenn Sie jetzt da das Standardbasis Koordinatensystem reinmalen, liegt das irgendwie komplett quer dazu. Und passt überhaupt nicht dazu. Aber Sie haben eben an der Stelle jetzt die schöne Freiheit, sich im ersten Schritt Ihr Koordinatensystem selbst zu wählen. Wenn Sie keins haben, dann nehmen Sie sich eins. Und jetzt nehmen Sie sich natürlich eins, das gut zu der Aufgabe passt.
03:27
Wenn man dann in diesem gewählten Koordinatensystem die Abbildungsmatrix hat und will sie jetzt unbedingt in der Standardbasis haben, weil die ganze restliche Rechnung in dem Projekt, was Sie gerade machen, der Standardbasis stattfindet, dann müssen Sie es halt umrechnen, aber dafür haben wir den Basiswechsel.
03:45
Also gesucht ist tatsächlich die Abbildungsmatrix in der Standardbasis, weil das ganze Projekt ist in der Standardbasis. Sie haben jetzt nur zwischendrin dieses Problem mit dieser Projektion. Also wir suchen die Abbildungsmatrix von Phi bezüglich B, und B ist die Standardbasis.
04:07
So, was Sie dafür brauchen, sind die, in der Abbildungsmatrix stehen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren. Also Sie müssen sich überlegen, was ist das Bild vom ersten Standardbasisvektor bezüglich der Projektion, und das kommt in die erste Spalte. Es ist nicht so wirklich offensichtlich, was mit dem Vektor 1,0,0 passiert, wenn Sie ihn in die geromische Richtung auf die Ebene projizieren.
04:27
Also machen wir anderes Vorgehen. Wir suchen uns, also wir betrachten eine der Abbildungen angepasste Basis, und jetzt ist die Überlegung, wie sieht die aus?
04:42
Also was ist eine dieser Linien an Abbildungen angepasste Basis? Das ist eine, von der Sie sehr schnell sagen können, was sind die Bilder der Basisvektoren. Von welchen Vektoren können Sie sofort sagen, worauf Sie abgebildet werden? Mehr ganz einfach sind die Vektoren in der Geraden da drin. Was passiert mit denen, die genau in Richtung Sonne gucken?
05:08
Wenn Sie die runterprojizieren, bleibt nicht viel übrig, die werfen keinen Schatten, denn Ihr Bild ist Null. Also das ist mal ein guter Vektor für unsere Basis, und von welchen Vektoren kennen Sie noch die Bilder?
05:21
Von allen Vektoren in der Ebene. Weil so ein Vektor in der Ebene, wenn Sie den projizieren auf die Ebene, dann passiert genau nichts. Der bleibt, so wie er ist. Das heißt, was wir suchen, ist eine Basis von unserem R3 aus Vektoren in der Ebene und in der Geraden, und die Vektoren haben wir. Dann nehmen wir die beiden Aufspannvektoren von der Ebene, 0, 1, 1, 1, 2, 1, und den Aufspannvektor von der Geraden, minus 4, minus 1, 2.
05:51
Jetzt müssen wir klären, dass das eine Basis ist. Es sind mal drei Vektoren, das ist ganz gut. Man muss checken, ob sie linear abhängig sind oder unabhängig. Für den Moment können Sie mir glauben, die sind linear unabhängig, oder Sie gucken sich das Bild an. Die sind linear unabhängig.
06:06
So, dann bestimmen wir jetzt die Abbildungsmatrix von Phi bezüglich dieser Basis. Und das ist nicht schwierig. Was brauchen wir? Wir brauchen die Bilder der Basisvektoren. Also diese Vektoren hier sind die Vektoren b1-strich, b2-strich, b3-strich.
06:24
Das ist die b-strich-Basis. Was ist das Bild von b1-strich? b1-strich liegt in der Ebene drin und wenn Sie jetzt auf die Ebene projizieren, kommt wieder b1-strich raus. Das Gleiche gilt für b2-strich. Wenn Sie den projizieren, kommt b2-strich raus. Und was ist mit b3-strich? Das ist der in der Geraden. Und da
06:46
hatten wir gesagt, wenn Sie den projizieren, hat er keinen Schatten, der produziert eine Null. Haben Sie also für die Vektoren sehr einfach die Bilder der Basisvektoren bestimmt? Jetzt brauchen wir die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren.
07:01
Und dann haben wir die Abbildungsmatrix von Phi bezüglich der b-strich-Basis. Was sind die Koordinaten von Phi von b1-strich in der gestrichenen Basis? Naja, einmal b1-strich plus Null mal b2-strich plus Null mal b3-strich, also 1, 0, 0. Die Koordinaten von Phi von b2-strich, also von b2-strich in der gestrichenen
07:23
Basis sind Null mal b1-strich plus einmal b2-strich plus Null mal b3-strich. Und die Koordinaten von Phi von b3-strich neben dem Null-Vektor, die sind einfach, die sind alle Null. Und dann haben Sie die Abbildungsmatrix. Sie sehen in dieser Abbildung angepassten Basis ist die Abbildungsmatrix wunderbar einfach.
07:47
Aber wir sollen ja nicht die Abbildungsmatrix bezüglich b-strich liefern. Stellen Sie sich ein größeres Projekt mit vielen Teilprojekten vor, jeder muss so lineare Abbildungen verwuschen, jeder verwendet eine andere Basis, das kriegen Sie nie zusammengesteckt. Das heißt Sie müssen sich auf eine gemeinsame Basis einigen und normalerweise wird das die Standardbasis sein.
08:06
Also müssen wir das Ding umrechnen auf die Standardbasis. Das war auch das Ziel. Wir suchen die Abbildungsmatrix von Phi bezüglich der Standardbasis. Und jetzt können wir unseren Basiswechsel ziehen. Also was sagte Satz 92?
08:21
Da habe ich Ihnen gesagt, oder ich hatte Ihnen noch als Beispiel danach gesagt, wenn Sie von der Standardbasis in eine andere Basis wechseln. Also das ist genau umgekehrt wie wir es jetzt machen, wir wollen von irgendeiner Basis in die Standardbasis. Aber wenn Sie von der Standardbasis in eine andere Basis wechseln, dann ist die Basiswechselmatrix ganz einfach zu bestimmen.
08:42
Dann kriegen Sie die nämlich einfach, indem Sie die neuen Basisvektoren in die Spalten schreiben. Wenn Sie diese Basiswechselmatrix nehmen, dann vermittelt die den Basiswechsel von der Standardbasis in die B-Strichbasis. Das ist genau falsch rum. Wir wollen von der B-Strichbasis in die Standardbasis.
09:03
Aber das ist erstmal die, die den Basiswechsel von der Standardbasis in die B-Strichbasis vermittelt. Also mit dem S kriegen Sie die Abbildungsmatrix in der B-Strichbasis von Phi bis S mal die Abbildungsmatrix in der Standardbasis von Phi mal S hoch minus eins.
09:22
Äh andersrum. S hoch minus eins mal die Standardbasis mal S. Warum schreibe ich Ihnen das hin, wenn das die falsche Richtung ist? Na ja, weil Sie jetzt den umgekehrten Basiswechsel daraus sofort folgern können, multiplizieren Sie mal die Gleichung von links mit S und von rechts mit S hoch minus eins.
09:44
Wenn wir das von links mit S multiplizieren, dann steht da S mal die Abbildungsmatrix in der gestrichenen Basis von Phi. Ist gleich und rechts steht S mal S hoch minus eins. S mal S hoch minus eins ist die Identität.
10:00
Also bleibt hier M, B, B, Phi mal S stehen. Jetzt habe ich aber gesagt, Sie sollten von rechts noch mit S hoch minus eins multiplizieren. Dann sieht das so aus. Und so haben Sie jetzt den umgekehrten Basiswechsel. Sie kriegen die Abbildungsmatrix von Phi bezüglich B, indem Sie jetzt eben andersrum S mal die Abbildungsmatrix bezüglich B-Strich mal S hoch minus eins multiplizieren.
10:22
So, jetzt bleiben nur noch zwei Dinge zu tun. Sie müssen S invertieren und Sie müssen zwei Matrixprodukte bestimmen. Das S invertieren, x sehe ich Ihnen wieder nicht vor, das dürfen Sie selber machen. Also, was ist S hoch minus eins? Nehmen Sie das S von da oben, stecken Sie es in den
10:45
Gauss-Algorithmus, rühren ein paar Mal kräftig rum und dann kriegen Sie die Matrix raus, 5, minus 6, 7. Minus 3, 4, minus 4, minus 1, 1, minus 1.
11:01
Und wer keine Lust auf den Gauss hat, kann zumindest kurz mal meine behauptete S hoch minus eins mit dem S da oben multiplizieren. Und da sollte bitte die Einheitsmatrix rauskommen. Gut, also, die Weise haben wir das S, das S hoch minus eins und jetzt ist es reines Rechnen und sich bitte nicht verrechnen. Also, S mal die Abbildungsmatrix, die wir gerade hatten, mal S hoch minus eins ausrechnen.
11:28
Also, was müssen Sie ausrechnen? M, B, B von Phi, das ist das, was wir haben wollen. Und wir hatten gesehen, das ist S mal die Abbildungsmatrix in der B-Strichbasis, mal S hoch minus eins.
11:45
Und das ist, S war 0, 1, 1, 1, 2, 1, minus 4, minus 1, 2. Das waren unsere drei angepassten Basisvektoren. Die Abbildungsmatrix in der B-Strichbasis, die war schön einfach, die hatte nur zwei Einsen und war sonst sehr nulllastig.
12:05
Und dann kommt die Inverse, 5, minus 6, 7, minus 3, 4, minus 4, minus 1, 1, minus 1. Und jetzt müssen Sie da rumrechnen. Das eine Matrixprodukt, also erste Matrix, mal diese in der Mitte, das geht noch ganz gut, weil da so schön viele Nullen sind.
12:26
Und dann hat man noch eine blöde Multiplikation, die ein bisschen mehr Aufwand ist. Und dann kommt am Ende raus, minus 3, 4, minus 4, minus 1, 2, 1, minus 1, und 2, minus 2, 3.
12:44
Und Sie sehen, das ist jetzt die Abbildungsmatrix von dieser Projektion bezüglich der Standardbasis. Und die so einfach zu erraten, wäre wohl nicht so schnell gegangen. Insbesondere sehen Sie jetzt, wenn Sie also den ersten Standardbasisvektor haben, dann wird der projiziert auf den Punkt minus 3, minus 1, 2.
13:03
Hätte man wahrscheinlich nicht direkt gesehen. Insofern ist dieser Umweg, wenn Sie die Aufgabe haben, finden Sie die Abbildungsmatrix zu irgendeiner schrägen Linie an Abbildungen. Meistens ist das Schnellste, suchen Sie sich eine passende Basis, bei der man die Abbildungsmatrix durch bloßes Draufgucken sieht.
13:21
Bestimmen Sie dazu die Abbildungsmatrix und dann machen Sie einen Basiswechsel. Das ist ein Standardverfahren, wenn man die Abbildungsmatrix bezüglich der Standardbasis haben will. Manchmal hat man Glück und die Abbildung ist so, dass die Standardbasis schon passt. Und dann sieht man schon bezüglich der Standardbasis, was die richtige Abbildungsmatrix ist.
13:41
Aber meistens liegen die Ebenen oder die Dinge, um die man dreht oder was auch immer gerade gefordert ist, schräg im Raum und dann ist die Standardbasis murks. Gut, das war der Teil konkretes Rechnen zu Sachen Basiswechsel.
14:03
Ich will noch kurz einen Begriff einführen und mich noch dem Spezialfall widmen, was ist, wenn Sie einen Basiswechsel bezüglich Ortonormalbasen haben. Die Standardbasis ist eine Ortonormalbasis und es gibt noch viele weitere Ortonormalbasen und in dem Fall ist der Basiswechsel noch ein Ticken einfacher.
14:22
Da Ortonormalbasen recht oft auftauchen, will ich Ihnen das nicht verschweigen. Aber erst noch ein Begriff, der sich relativ zwanglos im Moment ergibt, Definition 9.6. Wir haben gesehen, wenn Sie einen Basiswechsel machen, dann werden Matrizen, die die Abbildungsmatrix zu einer linearen Abbildung waren.
14:49
Also zu der gleich linearen Abbildung gehört dann eine andere Abbildungsmatrix. Und die Matrizen, die zu der gleich linearen Abbildung gehören, die wollen wir jetzt irgendwie zusammenfassen.
15:08
Die haben eine besondere Beziehung zueinander und das wollen wir mit einem Begriff belegen. Also zwei Matrizen aus dem KHN Kreuz N nennen wir ähnlich.
15:22
Und das ist tatsächlich kein von mir erfundener Begriff, sondern der ist so üblich, auch wenn er sich so ein bisschen albern anhört. Also die heißen ähnlich, wenn sie durch einen Basiswechsel miteinander umrechenbar sind. Das heißt, wenn es eine invertierbare Matrix gibt, also die nenne ich wieder S, wenn es eine Basiswechselmatrix, eine invertierbare Matrix gibt,
15:50
sodass sie das B schreiben können als S hoch minus 1 A S. Also wenn A die Abbildungsmatrix bezüglich irgendeiner Basis ist, dann ist B die bezüglich einer anderen Basis, die durch den Basiswechsel mit S gegeben ist.
16:04
Jetzt können Sie natürlich, also jetzt kommt Bemerkung 97. Der erste Punkt ist das, was ich gerade sagte. Wenn Sie Darstellungsmatrizen ein und derselben linearen Abbildungen, die sind immer zueinander ähnlich.
16:25
Also wenn Sie eine lineare Abbildung haben und Sie jetzt die Abbildungsmatrizen bezüglich verschiedenen Basen angucken, dann sind das immer ähnliche Matrizen. Und die Frage ist jetzt natürlich, gibt es überhaupt Matrizen, die sich nicht ähnlich sind?
16:41
Also kann ich nicht, wenn ich eine Abbildung habe und jetzt alle möglichen Basen betrachte, kriege ich da nicht alle Matrizen? Und die Antwort ist nein. Und das kann ich Ihnen aber erst in einer oder zwei Vorlesungen wasserfest begründen, dass die Antwort nein ist. Also ich schreibe mal, das ist Teil C, nicht alle Matrizen sind ähnlich und Begründung beweist Sie in einer Woche.
17:11
Sie werden erstaunt sein, überlegen Sie mal, wie könnte man das zeigen? Wie zeigt man, dass zwei Matrizen nicht ähnlich sind? Sie nehmen sich zwei her und dann müssen Sie zeigen, es gibt kein S, sodass das eine gleich S noch minus eins mal das andere mal S ist?
17:25
Schwierig, aber es gibt eine Methode, ja? Sie haben vollkommen recht. Okay, das ist noch einfacher. Die Idee ist die Nullmatrix. Wenn Sie sich überlegen, zu was die Nullmatrix ähnlich ist,
17:42
die Nullmatrix können Sie nur auf die Nullmatrix per Ähnlichkeitstransformation. Okay, also die Nullmatrix ist ein Sonderfall, aber dann gehen wir von der Nullmatrix weg. Sind alle außer der Nullmatrix zueinander ähnlich? Und auch hier ist die Antwort nein. Okay, jetzt kommen Sie mit der Einheitsmatrix. Die ist auch noch gut. Wenn Sie die Einheitsmatrix ähnlichkeitstransformieren, kommt auch immer die Einheitsmatrix raus.
18:03
Aber dann schließe ich die beiden aus. Das letzte, was ich noch sagen will, das können Sie gerne auch nochmal nachprüfen. So als Erinnerung und Fingerobringern. Ähnlichkeit ist eine Äquivalenzrelation und das bedeutet,
18:24
jetzt wieder machen wir jetzt nicht, aber Sie können die ganzen Matrizenklassen einteilen diese Äquivalenzklassen, die durch die Ähnlichkeit gegeben sind. Und da kommt eine ganze Menge Klassen raus. So, jetzt hatte ich gesagt, wir wollen uns noch anschauen, was passiert, also was ist
18:43
der Spezialfall von Basiswechsel, wenn sie Ortonormalbasen haben. Dann müssen wir uns natürlich, damit wir von Ortonormalbasen reden können, brauchen wir ein Skalarprodukt, damit wir Orthogonalität haben. Damit wir ein Skalarprodukt haben in dieser Folie, so müssen wir einen R-Vektorraum nehmen, weil wir Skalarprodukte nur auf reellen Vektorräume angeschaut haben. Also sei V ab jetzt ein endimensionaler R-Vektorraum. Und da drauf
19:08
ist irgendein Skalarprodukt gegeben, schreibe ich wieder mit den runden Klammern oder den Strichen in der Mitte. So, und dann haben wir jetzt eben zwei Ortonormalbasen auf V,
19:21
also B und B' seien Ortonormalbasen von V. Und meine Behauptung ist, wenn sie jetzt den Basiswechsel anschauen, also die Basiswechselmatrix, die ihnen den Übergang von der Basis B' zur Basis B
19:42
macht und deren Spalten, also die Spalten von dieser Basiswechselmatrix. Und wie ist diese Basiswechselmatrix definiert? Das hatten wir am Anfang des Kapitels. Sie kriegen die Basiswechselmatrix immer, indem sie sich die lineare Abbildung Identität anschauen und sich
20:05
die Abbildungsmatrix der Identität bezüglich dieser beiden Basen hernehmen. Also die Abbildungsmatrix Identität von V mit B' nach V mit B. Das ist S. Und wenn beides Ortonormalbasen
20:21
sind, dann hat dieses S eine besonders schöne Eigenschaft. Dann bilden nämlich die Spalten von S selbst wieder eine neuerliche Ortonormalbasis des Rn bezüglich des Standard-Scalar-Produkts. B und B' sind Ortonormalbasen in irgendeinem Vektorraum V. Das kann ein Polynomrahmen
20:49
oder sonst was sein. Und die Abbildungsmatrix lebt natürlich auf dem Rn. Und die Spalten dieser Abbildungsmatrix sind dann immer eine Unb bezüglich des Standard-Scalar-Produkts.
21:02
Und das werde ich in diesem Satz jetzt auch wieder mit den runden Klammern schreiben, aber hier unten schreibe ich Rn und hin und nicht V. Also das ist die Behauptung. Die Basiswechselmatrix zwischen zwei Unbs hat immer eine spezielle Struktur, nämlich die Spalten bilden eine Ortonormalbasis bezüglich des Standard-Scalar-Produkts.
21:26
Kann ich Ihnen zeigen. Also wir nennen unsere, geben mal den Basisvektoren in unseren Basennamen. Also die Basis B nenne ich B1 bis Bn und die Basis B' nenne ich B1- bis
21:46
Bn'. Das ist einfach nur Benahmsung. So, was ist jetzt die J-Spalte von S? Die nenne ich mal Sj sinnigerweise. Also Sj sei die J-Spalte von S. Was ist das? In den
22:05
Spalten und so weiter stehen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren. Also die J-Spalte von S enthält die Koordinaten des Bildes der Identität vom J-Basisvektor. Die Identität
22:25
bezüglich B. Das ist die J-Spalte. Und jetzt hatten wir im Abschnitt 4, ich behaupte das war die Bemerkung 4,15, hoffentlich stimmt das. Also in der Bemerkung dort gesehen,
22:45
sie brauchen die Koordinaten von Bj' bezüglich B. B ist eine Ortonormalbasis. Koordinaten bezüglich einer Ortonormalbasis ausrechnen ist einfach. Sonst ist das nervig, weil die Koordinaten bezüglich einer Basis ausrechnen, heißt sie müssen ein Linearskeilungssystem lösen. Aber bezüglich der UNB ist das einfacher. Bezüglich einer UNB kriegen
23:05
sie die Koordinaten, also kriegen sie diese J-Spalte, die da gegeben ist durch die Koordinaten von Bj' bezüglich B, indem sie ihren Vektor nehmen und jeweils Galarprodukt bilden mit den Basisvektoren. Also der erste Eintrag ist die Koordinate
23:23
bezüglich dem Vektor B1 und das ist Galarprodukt von Bj' mit B1 in V. Zweite Koordinate ist Galarprodukt von Bj' mit B2 in V und letztes ist Galarprodukt von Bj' mit Bn in V. So, das gibt ein Vektor und das ist dieser Koordinaten-Vektor. Sie sehen,
23:42
hier ist Koordinatenbestimmen viel einfacher, ist der Vorteil an Ortonormalbasen. Sie müssen N-Sgalarprodukte bestimmen und nicht ein N-Kreuz-N-Gauss lösen. So, und was ich jetzt behaupte, ist, diese Spalten bilden eine Ortonormalbasis. Das sind jetzt,
24:00
was jetzt in diesem Vektor steht, sind Zahlen in R, das ist jetzt ein Vektor in Rn. Soll ja auch so sein. Das ist ein Koordinaten-Vektor. So, meine Behauptung war, diese Vektoren bilden jetzt eine Ortonormalbasis. Was müssen wir also tun? Wir müssen zeigen, wenn wir uns zwei von den Vektoren hernehmen, also sie nehmen sich zwei Werte J und
24:22
K aus 1 bis N, gleich oder verschieden, ganz egal, dann müssen wir Sk mit Sj-Sgalarprodukt bilden, Standard-Sgalarprodukt und zeigen, da kommt Delta Jk raus, also da kommt 1 raus, wenn J gleich K und 0 sonst. Also, das müssen wir machen, wir müssen Skalarprodukt
24:41
von Sk mit Sj in Rn bilden, Standard-Sgalarprodukt und feststellen, dass da bitte schön Delta Jk rauskommen soll. Also, wie ist der Standard-Sgalarprodukt definiert? Sie summieren von 1 bis N, Lte Komponente mal Lte Komponente, also Bk-Sgalarprodukt mit Bl in V mal Bj-Sgalarprodukt
25:03
mit Bl in V. So, ja, kommt da jetzt Delta Jk raus? Was machen wir? Was da steht, muss ich gucken, warum ich es vorhabe, ja, betrachten Sie das mal als eine Summe über
25:24
Zahlen mal Skalarprodukte. Also, das erste Skalarprodukt ist einfach das Zahlen, Bl, äh, Cl, also das ist eine Summe, Cl mal das Skalarprodukt dahinten. Skalarprodukt ist linear im zweiten Argument, also dürfen Sie diese ganze Linearkombination
25:40
dahinten ins zweite Argument stecken. Das gibt große Skalarprodukt, Bj-, das ist dieses Bj- hier, Komma, und jetzt kommt die ganze Linearkombination ins zweite Argument, also Summe L gleich 1 bis N, Bk-, Bl in V mal Bl und das hier, Skalarprodukt
26:07
in V. So, das ist Linearität im zweiten Argument. Und jetzt muss man sich diese
26:27
Summe dahinten mal genau angucken. Was steht da? Da steht Linearkombination von den Vektoren B1 bis Bn, das ist die, ja, Summe Zahlen mal Bl und diese Zahlen,
26:45
diese Koeffizienten von der Linearkombination sind genau die Koordinaten des Vektors Bk- in der B1 bis Bn-Basis. Was hier also steht, ist ziemlich kompliziert, Bk-,
27:01
Wiederbemerkung 4.15. Also, das hier ist Wiederbemerkung 4.15. So, also was hier steht, ist aufgepustet Bj-Bk-. Ja, aber B1- bis Bn- ist eine Omb. Also ist das
27:24
Skalarprodukt von Bj- und Bk-delta jk, weil das B- ist eine Ortonormalbasis. Und damit sind auch die Spalten von unserer Matrix eine Ortonormalbasis. Jetzt könnten Sie sagen, hübsche Spielerei, das bringt einem das, dass die Spalten Omb sind. Gut,
27:43
es gibt einem erstens ein ganz, wenn man wirklich konkret mit so Zeug rechnet, einen simplen Check, ob man sich beim Bestimmen der Basiswechselmatrix nicht vertan hat. Also, wenn Sie zwischen zwei Omb wechseln und Sie haben eine Basiswechselmatrix, und irgendeine Spalte ist 1, 1, 0, dann ist irgendwas schiefgegangen. Weil, wenn
28:04
Sie zwischen zwei Omb wechseln, müssen die Spalten der Basiswechselmatrix eine Ortonormalbasis bilden. Das heißt, zumindest mal jede Spalte muss normiert 1 sein. Das ist ein Punkt, weshalb das hilft, aber es
28:21
gibt noch einen zweiten, auf den komme ich jetzt. Zunächst mal haben wir jetzt also eine Sorte von Matrizen, die eine schöne Eigenschaft haben, nämlich, dass ihre Spalten eine Omb bilden. Und damit man nicht jedes Mal sagen muss, sei A eine Matrix, deren Spalten eine Omb bilden, kriegen die einen Namen. Also eine Matrix A
28:42
aus dem N-Kreuz N heißt orthogonal. Ebenfalls genau das ist. Also falls die Spalten von dieser Matrix A eine Omb bezüglich dem Standard-Skalarprodukt bilden.
29:07
Ich gehe zu, dass der Begriff orthogonal irgendwie doof ist. Ortonormal wäre besser, weil die Spalten sind eine Ortonormalbasis. Warum nennt man die Matrix dann orthogonal? Fragen Sie nicht mich. Das heißt halt so. Also die
29:21
Matrizen heißen orthogonal, wenn die Spalten eine Ortonormalbasis bilden. So, und erste wichtige Sache, sich zu merken oder sich klar zu machen,
29:45
orthogonale Matrizen sind immer invertierbar. Warum? Weil die Spalten bilden eine Omb. Das heißt, die Spalten sind alle Linien unabhängig. Das heißt,
30:01
der Rang ist N. Und wenn der Rang N ist, dann ist die Matrix invertierbar. Das ist schon mal eine schöne Eigenschaft von orthogonalen Matrizen. Also ich schreibe nochmal da Rang von A gleich N. Und dann hatte ich Ihnen gesagt, orthogonale Matrizen sind auch deswegen
30:22
angenehm, weil wenn Sie mit denen den Basiswechsel machen, also wenn Sie den Basiswechsel zwischen zwei Ortonormalbasen machen, können Sie sich Arbeit sparen. Und das ist der Inhalt von der Übungsaufgabe 9 10. Siehe Übungsblatt 12. Und die gibt Ihnen einen ganzen Haufen äquivalente Formulierungen für A ist orthogonal. Also wenn Sie eine Matrix
30:46
haben aus dem R hoch N Kreuz N, dann sind die folgenden Aussagen äquivalent. Also logisch äquivalent. Erstens, diese Matrix ist nicht irgendeine, sondern eine orthogonale Matrix.
31:06
Zweitens, A ist invertierbar. Das reicht noch nicht. Es gibt durchaus invertierbare Matrizen, die nicht orthogonal sind. Aber A ist invertierbar und die Inverse hat eine
31:20
besonders einfache Form. Die Inverse ist nämlich gleich der transponierte. Also wenn A orthogonal ist, dann ist die Inverse gleich der transponierten. Und umgekehrt, wenn Sie eine invertierbare Matrix haben, deren Inverse gleich der transponierten ist, dann ist es eine orthogonale Matrix. Ich hatte ihn orthogonal definiert über die Spalten als
31:43
O N B. Das Gleiche geht über die Zeilen. Also eine Matrix ist genau dann orthogonal, wenn die Zeilen von A eine O N B bezüglich des Standardskalarprodukts liefern. Also das
32:05
Zeilen oder Spalten ist egal. D ist das jetzt schon. A ist orthogonal genau dann, wenn es invertierbar ist und auch die Inverse orthogonal ist. Also wenn Sie eine
32:23
orthogonalen Matrix haben, dann ist immer auch die Inverse eine orthogonalen Matrix. Das wiederum überrascht uns jetzt überhaupt nicht. Was sind orthogonalen Matrizen? Das sind Basiswechselmatrizen zwischen zwei Ortonormalbasen. Und wenn A die Basiswechselmatrix zwischen der Ortonormalbasis B zur Ortonormalbasis C ist, dann ist auch minus 1 die Basiswechselmatrix
32:46
von der Ortonormalbasis C in die Ortonormalbasis B und natürlich auch orthogonal. So und letztens A transponiert ist orthogonal. So und was ist abgesehen davon, dass das ein
33:02
riesen Satz von schönen Aussagen über orthogonalen Matrizen ist, was ist das Haupt nutzbare davon? Wenn Sie sich erinnern, wann immer Sie einen Basiswechsel machen müssen, müssen Sie die Inverse von der Matrix ausrechnen. Und wenn die Matrix relativ groß ist, kann das ziemlich ätzend sein, so eine Inverse auszurechnen. Wenn Sie auf dem nächsten Übungsblatt auch feststellen. Und wenn Sie jetzt in B gucken, stellen Sie fest, Inverse
33:24
von orthogonalen Matrizen ausrechnen ist dem gegenüber ein Spaziergang. Weil transponieren ist einfach. Spalten und Zeilen tauschen, das kriegen wir hin. Das ist deutlich angenehmer als den vollen Gauss durch X. Also wenn Sie ein Basiswechsel zwischen zwei Ortonormalbasen haben und Sie müssen ihn wirklich durchrechnen, fangen Sie bitte
33:43
nie, niemals an die Matrix zu invertieren. Also Sie müssen sie invertieren, aber denken Sie an den Satz und nehmen Sie einfach die transponierte. Das spart Ihnen zig Rechenfehler und viel Nerv. Gut, also im Skript steht jetzt noch, dass diese Menge aller orthogonalen
34:08
Matrizen, die ist in der Gruppentheorie, vor allem in den Lie-Gruppen ganz wichtig, wird sie aber nicht besonders oft, vielleicht kommt sie irgendwie mal in unter die Finger, ist die sogenannte orthogonale Gruppe, weil die orthogonalen Matrizen mit dem Multiplizieren
34:23
tatsächlich eine Gruppe bilden. Wieder eine nette Übungsaufgabe, um so ein bisschen altes Zeug herauszufischen. Was war das noch mit Gruppe? Also zeigen Sie alle orthogonalen Matrizen mit der Multiplikation sind eine Gruppe. Gut, das ist das, was
34:41
ich zum Thema Basiswechsel sagen wollte. Und jetzt kommen noch zwei Kapitel in der Linie an Algebra, die für verschiedene Dinge wichtig sind. Aber das Ziel, sage ich jetzt mal, ist noch die eine offene Frage zu klären, die wir gestern, Quatsch, am letzten
35:05
Freitag hatten. Da hatte ich eben diesen miraculösen Basiswechsel hingeschrieben, der die Matrix so vereinfacht hat, und die Frage war, wo kriegen wir den her? Und das ist das eins der Ziele der nächsten zwei Abschnitte. Und das erste, was wir dazu
35:21
brauchen, ist noch ein ganz, ganz wichtiges Rechenmittel. Und die, die die Vorlesungen schon mal gehört haben und werden Ihnen sicher auch bestätigen, dass man das Zeug häufiger braucht, sind die sogenannten Determinanten. Also, das ist erst mal
35:42
das Wort. So, was ist die Idee? Ich gehe noch mal zu dem Thema Invertieren von Matrizen. Dann haben Sie ihn noch nicht gesehen, aber nach dem nächsten Übungsblatt werden Sie es gesehen haben. Wenn Sie irgendeine Zweikreuz-Zwei-Matrix haben, dann kann
36:06
man die Inverse sehr leicht hinschreiben. Wenn sie denn existiert. Also die Frage ist, wann ist A invertierbar? Wie sieht man das? Wenn A die Null-Matrix ist, sieht man das schnell, dass sie nicht invertierbar ist. Aber wenn da irgendwelche Zahlen rumstehen, kann das mühsam sein. Und gut, bei einer Zweikreuz-Zwei-Matrix
36:26
kann man sich noch einmal sagen, gut, ich beiße einen sauren Apfel, setze mich fünf oder zehn Minuten hin und rechne den Gauss für die Inverse einmal allgemein durch. Einmal für alle Zeiten. Wenn Sie das machen, dann kriegen Sie folgendes aus. Eins durch eine spezielle Zahl, nämlich A mal D minus B mal C, kriegen Sie aus
36:48
diesen vier Zahlen. Und dann ist es der Rest kein Hexenwerk mehr, Sie müssen die Hauptdiagonale vertauschen. Also das D kommt nach oben, das A kommt nach unten. Und auf der Nebendiagonale kriegen Sie Minuszeichen. Das ist die allgemeine
37:05
Inverse. Das ist eine Gauss-Übung. Bisschen nervig, aber wenn man die einmal gemacht hat, hat man es für alle Zeiten. Und das geht. Und diese ganze Rechnung, die Sie sehen schon, kann nur funktionieren, wenn diese Zahl hier unten, die da im Länderstift bitteschön nicht null ist. Wenn A mal D minus B mal C null ist, dann steht hier
37:21
Unfug. Und tatsächlich stellt sich raus, es hängt genau an dieser Zahl. Also das Ding ist invertierbar, wenn A mal D minus B mal C ungleich null ist. Dann ist das die Inverse. Und wenn das null ist, dann geht es nicht. Also ist diese Zahl irgendwie wichtig. Und diese Zahl ist für 2 Kreuz 2 Matrizen das, was die Determinante ist.
37:43
Also die Determinante von A ist A mal D minus B mal C. Und das ist eine Größe, die Ihnen sagt, ob die Matrix invertierbar ist oder nicht. Im Prinzip können Sie die Größe als Maß auffassen, wie invertierbar eine Matrix ist. Je weiter die weg von
38:03
Null ist, desto schöner ist sie invertierbar. Das ist natürlich, mein invertierbar ist invertierbar. Das ist insofern interessant, wenn Sie mit den Matrizen rechnen und wenn Sie eine sehr, sehr kleine Determinante haben und jetzt invertieren, dann werden, schauen Sie sich oben den Ausdruck für A auch minus 1 an. Wenn das A mal D minus B mal C
38:21
sehr klein ist, dann werden die Ausdrücke von A auch minus 1 sehr groß. Das entspricht dem, dass wenn Sie eine Zahl ganz nah bei Null eins durchnehmen, kommt eine ganz große Zahl raus. Und das bedeutet, wenn Sie wirklich jetzt auf dem Rechner oder mit solchen Matrizen zu tun haben, werden die Fehler sehr groß. Wenn Sie auf dem Rechner
38:40
arbeiten, müssen Sie immer runden. Und das ist, ich glaube Nader hatte das auch im letzten Treffpunkt angesprochen, da kommen Sie in die Frage der sogenannten Kondition. Also wie stabil ist so eine Rechnung unter Rundungsfehlern? Und je kleiner die Determinante, je näher die Determinante an Null rutscht, umso kritischer wird die Rechnung. Umso instabiler unter Rundungsfehlern wird die Rechnung. Deswegen
39:04
ist das auch ein interessantes Maß für so eine Matrix. Aber im Prinzip sagt sie erst mal, wenn sie Null ist, ist die Matrix nicht invertierbar. Wenn sie nicht Null ist, ist die Matrix invertierbar. So, das ist die Determinante für 2 Kreuz 2
39:22
Matrizen. Die Determinante gibt es auch für N Kreuz N Matrizen. Und sie tut da genau das Gleiche. Sie gibt Ihnen Maß dafür, ob das Ding invertierbar ist oder nicht. Und damit ist sie ein total praktisches Hilfsmittel für alle möglichen Dinge. Weil was bedeutet das, wenn der N Kreuz N Matrix invertierbar ist? Das bedeutet, die Spalten sind linear unabhängig. Genau dann. Genau dann,
39:43
wenn die Spalten linear unabhängig sind, ist das Ding invertierbar. Und genau dann, wenn das Ding invertierbar ist, ist die Determinante nicht Null. Das heißt, die Determinante gibt Ihnen auch eine Methode, um linear Unabhängigkeit zu testen. Stecken Sie, wenn Sie N Vektoren haben wollen, wissen Sie, wie linear unabhängig ist, stecken Sie in der Matrix rein, drehen Sie die Determinante aus, kommt Null raus oder kommt nicht Null raus. Also,
40:03
es ist ein ganz, ganz weit verbreitetes Hilfsmittel. Und jetzt kommt der Pferdefuß an der Sache. Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, wie man Determinanten definieren kann. Wie man Determinanten in der Vorlesung einführen, motivieren kann. Und alle drei sind furchtbar. Alle drei sind didaktisch katastrophal. Entweder sie sind super abstrakt und
40:25
elegant und keiner weiß, wie man das Zeug ausrechnet. Oder man erklärt, wie man es ausrechnet und dann weiß man nicht, wo es herkommt. Die sind alle furchtbar. Und ich habe mich halt für eine furchtbare entschieden und definiere Ihnen jetzt die Determinante rekursiv. Glauben Sie mir, es ist,
40:44
glaube ich, die, die Sie am schönsten finden. Bin ich ziemlich sicher. An der Stelle habe ich keine mathematischen Gemeinheiten ausgepackt, sondern versucht, so zu machen, wie wir am besten miteinander auskommen. Also die Definition 10, 1, die Determinante. Also wir haben eine N-Kreuz-N-Matrix und von
41:10
der wollen wir die Determinante definieren. Dann brauchen wir noch eine Hilfskonstruktion, das sogenannte algebraische Kompliment. Aber den Namen können Sie gleich wieder vergessen. Und zwar sortieren wir unserer Matrix A jetzt
41:25
eine Matrix zu, die eine Dimension kleiner ist. Also N-1 Kreuz N-1. Wir wollen rekursiv Determinanten definieren. Also müssen wir die Determinante von der N-Kreuz-N-Matrix auf eine N-1 Kreuz N-1-Matrix zurückspielen und am Schluss dann auf 1 Kreuz 1-Matrizen oder 2 Kreuz 2, für
41:40
die haben wir es auch schon dastehen. So, also brauchen wir die richtige N- Minus 1 Kreuz N-1-Matrix und die bezeichne ich mal mit A, J, K. Das ist also eine N-Minus-1 Kreuz N-Minus-1-Matrix. Und die kriegen Sie aus dem A relativ einfach, nämlich sie nehmen sich die Matrix A und streichen
42:07
die J-Zeile und die Karte Spalte. Also A, J, K ist die Matrix, wo sie die J-Zeile und die Karte Spalte raus gestrichen haben. Also A, 1, 1. Wir streichen
42:21
erste Zeile, erste Spalte, bleibt N-Minus-1 Kreuz N-Minus-1 übrig. So, das ist ein reines Hilfsmittel. Das braucht man genau, um Determinanten zu definieren, danach vergisst man es wieder. Und jetzt können wir rekursiv definieren, was eine Determinante ist. Und das fangen wir mit den
42:40
kleinstmöglichen Matrizen an, nämlich mit 1 Kreuz 1-Matrizen. 1 Kreuz 1-Matrizen sind Zahlen, enthält ein Element Alpha, also Alpha 1, 1. Da hat man nicht viel Auswahl, was ist die Determinante von so einer Matrix, die nennen wir halt Alpha. Und Sie sehen, dann passt das auch. Wann ist so eine
43:03
1 Kreuz 1-Matrix invertierbar? Naja, wenn sie nicht Null ist. Wann ist Alpha nicht Null? Wann ist die Determinante nicht Null? Naja, wenn Alpha, wenn die Determinante Alpha ist, dann ist das Ding invertierbar. Genau dann, wenn die Determinante nicht Null ist. So, das ist der einfache Fall, das ist nur
43:20
der rekursionsanfang. Und jetzt müssen wir die Determinante von der n Kreuz n-Matrix auf die Determinante von n-1 Kreuz n-1-Matrizen zurückspielen. Also geben wir uns eine n Kreuz n-Matrix her. Alpha jk, jk gleich 1 bis n.
43:40
Das ist eine n Kreuz n-Matrix. Und jetzt ist das n größer als 1. Und dann definieren wir uns die Determinante. Also wieder Bezeichnung det von a. So, jetzt haben Sie
44:03
also Ihre Matrix. Und was Sie jetzt machen, ist folgendes. Sie gehen die erste Zeile der Matrix entlang. Also Sie summieren von k gleich 1 bis n. Nehmen jeweils aus der ersten Zeile das Element in der Kartenspalte. Das ist Alpha 1k. Dann streichen Sie aus Ihrer Matrix genau die erste Zeile
44:26
und die Kartenspalte raus. Das ist dieses a1k. Das ist jetzt n Kreuz 1 mal n Kreuz 1. Davon wissen wir rekursiv schon, was die Determinante ist. Und alle diese Zahlen, die Sie jetzt hier kriegen, die Determinante von der
44:41
Matrix sind eine Zahl, summieren Sie auf. Aber Sie summieren sie nicht einfach nur auf, sondern Sie summieren sie noch mit wechselnden Vorzeichen auf. Also es kommt noch ein minus 1 hoch 1 plus k dazu. Also den oben links, der ist k gleich 1. Da haben Sie minus 1 Quadrat. Das ist 1. Den oben links, den multiplizieren Sie mit plus 1. Den nächsten mit minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 und so
45:04
weiter abwechselnd. Und dann kommt dieses ganze Zeug da zusammen. Und das ist Definition der Determinante. Ich gebe zu, ist nicht hübsch, aber so muss man es definieren, damit es sinnig ist. Und diese Formel hier, die heißt
45:21
Entwicklung der Determinante nach der ersten Zeile. Ja, damit ist es jetzt definiert. Sie wissen es für 1 Kreuz 1 Matrizen und Sie haben eine Formel, wie Sie für eine n Kreuz n Matrix Determinante ausrechnen, wenn Sie die Formel für n minus 1 Kreuz n
45:43
minus 1 Matrizen haben. Ich behaupte nicht, dass man es damit besonders effizient ausrechnen kann. Aber es ist zumindest mal definiert. Es gibt noch eine alternative Schreibweise, die will ich noch kurz einführen, weil wir sie
46:01
oft verwenden werden auch. Und wenn man sie oft sieht, wenn Sie die Matrix A konkret haben, ja dann können Sie die ja immer als so ein Zahlenschema hinschreiben. alpha 1 2 alpha 1 n alpha 2 1 alpha 2 2 bis alpha 2 n und alpha n 1 alpha n 2 bis
46:24
alpha n n. Also Determinanten sind eben, es geht um Invertierbarkeit im quadratischen Matrizen definiert. Und dann würde man, wenn es eine Matrix wäre, runde Klammern drumrum machen und die Determinante bezeichnet man mit geraden Klammern. Also das ist noch so eine Schreibweise für die Determinante,
46:40
die man oft sieht. Damit ist Definition zumindest erledigt. Ich lasse sie mit der, lasse die jetzt mal kurz 10 Minuten verdauen. Hier steht sie noch mal fürs folgende und machen wir erst mal ein Päuschen. So, ich würde dann gerne die zweite Hälfte einsteigen und damit anfangen, dass wir uns
47:03
mal langsam an diese Formel da gewöhnen. Also rechnen wir mal ein bisschen Beispiel. Und ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen noch ein bisschen Methoden an die Hand legen, wie das Determinantenberechnen einfacher wird. Wundervoll bringen wir nicht, das soll
47:25
heißen, beliebig-einfach wird es nicht. Determinantenberechnen ist kompliziert, oder was heißt kompliziert? Es ist reine Algorithm und einfach Rechnen mit Zahlen. Aber es ist, wenn die Matrizen groß werden, sind es sehr, sehr lange Formeln.
47:40
Das lässt sich auch, das wird sich auch nie ändern lassen. Es gibt so ein paar Tricks, mit denen man sich helfen kann, aber der Stein der Weisen wird da nicht dabei. So, als erstes schauen wir mal, dass wir unser Ergebnis von vorher wiederfinden. Also was ist die Determinante von der 2 Kreuz 2 Matrix?
48:01
Ist das, was wir jetzt hier definiert haben, das was kommt da, also das ad minus bc raus, was rauskommen soll. Also müssen wir uns durch diese Definition wühlen. Die Determinante von der 2 Kreuz 2 Matrix ist erklärt als eine Summe von irgendwelchen Linearkombinationen von 1 Kreuz 1 Determinanten. Also müssen nach der ersten Zeile entwickeln. Wir gehen die
48:23
erste Zeile entlang und addieren diese Terme auf, dann kommt zuerst das wechselnde Vorzeichen. Also für den ersten Eintrag, für das Element links oben in der Ecke, für a ist das k1. Dann haben sie minus 1 hoch 2, also plus 1
48:41
da stehen. Allgemein ist dieses Vorzeichen, müssen Sie sich immer vorstellen, über die Determinante gelegt wie so ein Schachbrettmuster. Also an der Stelle hier ist das plus, hier ist das minus, da ist es minus, da ist es plus. Geht auch für größere Determinanten. Dieses Vorzeichen liegt immer wie ein
49:00
Schachbrettmuster über der Determinante und oben links haben sie immer ein Pluszeichen. Weil oben links ist immer das Element 1, 1 und 1 und 1 ist 2. Und minus 1 Quadrat ist positiv. So, also haben wir, wenn wir die erste Zeile angucken, fängt das mit einem positiven Vorzeichen an, also entwickeln die erste Zeile. Dann ist der erste Term, also plus 1, also ich schreibe es
49:27
ganz ausführlich hin, minus 1 Quadrat, mal das a, also der Eintrag an der Stelle 1, 1, mal die Determinante von dem a, 1, 1, plus der zweite Term ist
49:42
minus 1 hoch 1 plus 2, also minus 1 hoch 3, das ist das negative Vorzeichen, mal der Eintrag, mal die Determinante a, 1, 2. Das ist was, die minus 1 Quadrat ist eine 1, also steht hier a, mal die a, a, 1, 1, ist die 1 Kreuz 1 Determinante,
50:00
die sie kriegen, wenn sie die erste Zeile und die erste Spalte streichen. Also die 1 Kreuz 1 Determinante, die dann nur das D enthält. Die Determinante der Matrix D, für 1 Kreuz 1 Determinanten bitte nicht die Schreibweise mit senkrechten Strichen und D dazwischen, weil das verwechselt man so leicht mit Betrag. Also a, mal Determinante der 1 Kreuz 1
50:22
Matrix D, minus b, mal Determinante der 1 Kreuz 1 Matrix, die sie kriegen, wenn sie die erste Zeile und die zweite Spalte löschen, das ist C. Naja und für 1 Kreuz 1 Determinanten ist die Determinante gleich dem Wert a, d, minus b, c. Sieht gut aus.
50:41
So, das Ganze mal eine Dimension größer und dann sehen sie schon, dass Determinanten berechnen nach Definition keinen Spaß macht. 2, 1, 3, 4, 0, 5, 7, 6, 8. Ziemlich egal, was wir da reinschreiben. Wieder das Schachbrettmuster drüberlegen. Wenn sie entwickeln, haben sie hier ein
51:02
Plus. Geht auch so weiter, interessiert im Moment noch nicht. So, wir müssen die erste Zeile entlang laufen. Was kriegen wir? Wir kriegen plus 1, mal 2, mal die Determinante, die sie kriegen, indem sie die erste Zeile und die erste
51:22
Spalte streichen. Das ist die Determinante 0, 5, 6, 8, minus 1, mal, das ist jetzt diese 1 hier. Wir gehen die erste Zeile entlang und streichen immer die erste Zeile und die entsprechende Spalte raus. Also diese 1
51:41
mal die Determinante, die sie kriegen, indem sie die erste Zeile und die zweite Spalte streichen. Wenn sie die erste Zeile und die zweite Spalte streichen, bleibt übrig 4, 5, 7, 8. Es kommt wieder ein Plus-Vorzeichen. Der Wert, der da steht, 3, mal die Determinante, die sie kriegen, wenn sie die erste Zeile und die dritte Spalte streichen. Das ist die
52:03
Determinante 4, 0, 7, 6. Jetzt können sie wieder die Determinanten, die da übrig bleiben, nach der gerade gefundenen Regel durchxen. Also 2, mal 0, mal 8, minus 5, mal 6, minus 1, mal 4, mal 8, minus 5, mal 7, plus 3,
52:23
4, mal 6, minus 0, mal 7. Das ist jetzt rechnen mit ganzen Zahlen und am Schluss kommt 15 raus. Sie sehen, wenn ich Ihnen jetzt eine 7-kreuz-7-Matrix hinmache, dann wird jeder von Ihnen fluchen.
52:42
Dann muss man erst auf 6-kreuz-6 und dann 5-kreuz-6. Das macht keinen Spaß. Also müssen wir uns überlegen, wie wir an die Determinante etwas effizienter an die Determinante kommen. Noch ein Kommentar. Es ist trotzdem, wenn Sie sich jetzt überlegen, was haben wir damit gezeigt? Wir haben damit gezeigt, die Determinante von dem Ding da oben ist 15. Also Sie kriegen die Invertierbarkeit
53:03
von dieser Matrix damit sofort. Sie haben noch nicht die Inverse, aber Sie haben die Invertierbarkeit. Wenn Sie das mit Gauss gemacht hätten, dauert es schon auch ein bisschen länger. So, insofern ist schon ein kleiner Gewinn da. Also überlegen uns, wie wir effizienter an die
53:23
Determinante kommen. Und die Antwort wird auch hier Gaussverfahren sein, witzigerweise. Das Gaussverfahren haben wir für lineale Gleitungssysteme entwickelt. Und wir werden feststellen, zum Bestimmen von Determinanten ist es mindestens genauso toll und genauso wichtig. Aber dazu zunächst mal eine Beobachtung. Nämlich es gibt eine besonders schöne Sorte von
53:44
Matrizen, für die die Determinante leicht zu bestimmen ist. Und das sind sogenannte Dreiecksmatrizen. Also wenn Ihre Matrix aus K hoch N Kreuz N, ich mache es mal für untere Dreiecksmatrizen. Wir werden später sehen, dass das ziemlich egal ist. Also eine untere
54:03
Dreiecksmatrix ist. Was will ich damit sagen? Was heißt untere Dreiecksmatrix? Das heißt, dass das Dreieck oben rechts in der Matrix nur aus Nullen besteht. Und unten links sind Werte, deswegen untere
54:21
Dreiecksmatrix. Das heißt, gut, Sie haben auf der Diagonale von Ihrer Matrix E immer die Zahlen alpha 1, alpha 2, 2 bis alpha N entstehen. Und eine untere Dreiecksmatrix ist jetzt dadurch gekennzeichnet, dass hier Nullen stehen. Und was hier unten steht, ist mir total egal. Da steht irgendwas. Also Sie haben die Diagonale und Sie haben oben
54:47
rechts Nullen. Das ist das Wichtige. Und wenn Sie so eine spezielle Matrix haben, dann kriegen Sie die Determinante super schnell. Warum? Naja, Definition. Was ist die Determinante davon? Gehen Sie die
55:03
erste Zeile durch, multiplizieren Sie den richtigen Vorzeichen, mal den Wert, mal die Determinante, die Sie kriegen, indem Sie streichen. Aber wenn Sie die erste Zeile durchgehen, haben Sie nur einen einzigen Beitrag, nämlich von der ersten Spalte. Und danach kommt mal Null, mal Null, mal Null, mal Null, mal Null, mal Null, mal.
55:21
Das heißt, wenn Sie jetzt nach der ersten Zeile entwickeln, kriegen Sie plus 1, mal alpha 1, 1, mal die Determinante, die übrig bleibt, durch streichen der ersten Zeile und der ersten Spalte. Was ist das? Das ist die Determinante, die hier mit alpha 2, 2 anfängt, bis alpha N, N geht. Die hat hier oben wieder lauter Nullen.
55:43
Und hier unten steht irgendwas, was mir total egal ist. Das heißt, es ist wieder eine untere Dreiecksmatrix. Jetzt kommt eigentlich plus Null, mal das, was Sie kriegen, wenn Sie die erste Zeile und die zweite Spalte streichen, aber Null, mal irgendwas ist Null. Und so geht das durch. Also das ist jetzt alles.
56:02
Und so können Sie weitermachen. Jetzt entwickeln Sie das wieder. Dann kriegen Sie alpha 1, 1, alpha 2, 2, mal die untere Dreiecksmatrix, die jetzt bei 3, 3 anfängt. Hier oben stehen Nullen, da unten steht irgendwas. Und so geht das weiter und weiter.
56:21
Und am Schluss kommt raus alpha 1, 1, alpha 2, 2, alpha 3, 3, bis alpha N, N. Also für eine untere Dreiecksmatrix kriegen Sie die Determinante einfach als Produkt der Diagonalenträge fertig. Das ist ziemlich simpel gegenüber dem anderen Schrott.
56:42
Insbesondere haben Sie damit sofort für eine besonders wichtige Determinante die Determinante bestimmt. Was ist damit die Determinante der Einheitsmatrix? Die Einheitsmatrix ist eine speziell schöne untere Dreiecksmatrix. Die ist nämlich gleichzeitig auch eine obere Dreiecksmatrix. Die hat nur Diagonalenträge und gar nichts nebendran.
57:01
Es ist insbesondere eine untere Dreiecksmatrix. Und die Diagonalenträge sind alle 1. Also ist die Determinante 1, mal 1, mal 1, mal 1, mal 1, mal 1. Je nachdem, wie groß sie ist, N mal 1 hoch N, also 1. Was gut zu dem korrespondiert, dass die Einheitsmatrix invertierbar ist.
57:21
Die Determinante ist nicht 0. Gut, also, die Determinante der Einheitsmatrix ist immer 1. Wurscht unabhängig, was die Dimension ist. Und Sie sehen, es ist also vorteilhaft, wenn wir Determinanten von unteren Dreiecksmatrizen bestimmen können. Die können wir gut bestimmen, wenn wir das irgendwie
57:41
unser Determinantenbestimmungsproblem zurückspielen auf untere Dreiecksmatrizen. Wie kann man aus einer Matrix eine untere Dreiecksmatrix machen? Gauss-Verfahren. Wenn Sie beim Gauss-Verfahren arbeiten, was machen Sie? Sie machen möglichst viele Nullen da rein. Das ist das Ziel vom Gauss-Verfahren, dass die Matrix im Prinzip, wenn es ideal läuft, am Schluss in der Einheitsmatrix ist.
58:03
Aber zumindest so, dass Sie untere Dreiecksmatrix haben, damit Sie rückwärts einsetzen können. So, was wir also wissen müssen, ist, was passiert mit der Determinante von der Matrix, wenn Sie bei der Matrix irgendwelche Gausschritte machen. Und das ist der Inhalt vom nächsten Satz.
58:22
Das ist ein Stapel Rechenregeln für die Determinante, den ich Ihnen hier ohne Beweis hinklatschen werde. Aber im Lesen ist immer die Frage, was passiert mit der Determinante, wenn Sie Elementarumformungen des Gauss-Verfahrens machen.
58:44
Und Sie werden feststellen, bei allen Verfahren, bei allen Umformungen, die Sie im Gauss machen, passieren sehr leicht merkbare Dinge mit der Determinante, die man gut mitführen kann. Und insofern wird sich das Gauss-Verfahren beweisen als die Methode zum Bestimmen von Determinanten.
59:04
Also, wir haben eine Matrix A n Kreuz n. Und ich nenne mal gleich die Zeilen dieser Matrix A 1 bis A n. Also, dies sind aus K hoch n Kreuz, ist eine n Kreuz n Matrix.
59:21
Und die Vektoren A 1 bis A n, das seien jeweils die Zeilen von A. So, erste Rechenregel. Was machen wir beim Gauss-Verfahren? Wir vertauschen Zeilen.
59:41
Das vertauschen von Zeilen ändert beim Gauss-Verfahren nichts an der Lösungsmenge. Achtung, bei Determinanten ändert das was. Aber nicht besonders dramatisch. Wenn Sie zwei Zeilen vertauschen, dann multipliziert das die Determinante mit minus 1. Also, Zeilen vertauschen.
01:00:00
switcht das Vorzeichen. Das heißt, wann immer Sie die Determinante bestimmen und zwei Zeilen vertauschen, dann müssen Sie das Vorzeichen drehen. Also, wenn Sie zum Beispiel die Determinante anschauen, in dem Beispiel von hier A1,
01:00:25
wenn Sie eben die beiden ersten Zeilen vertauschen, A2, A1, A3, A4 bis An, also A1 und A2 getauscht, dann ist das Minus-Determinante von A. Wenn Sie jetzt auch noch A3 und A4 tauschen, haben Sie wieder die Determinante von A.
01:00:41
Oder wenn Sie A4 mit A8 tauschen, wurscht, irgendwelche zwei Zeilen getauscht, switcht das Vorzeichen um 1. So, zweiter schöner Punkt, die Determinante ist linear. Und zwar linear in jeder Zeile.
01:01:01
Das heißt, wenn Sie in irgendeiner Zeile eine Linearkombination von zwei Vektoren stehen haben, können Sie das auseinanderziehen. Also, wie kann man das noch anders hinschreiben? Was auch immer Sie für eine Zeile nehmen, also ein J zwischen 1 und N,
01:01:24
alle B aus KN, genauer gesagt müssen wir, weil das Zeilen sind, transponiert aus KN, und alle Lambda und Mu aus K, gilt Folgendes.
01:01:41
Also, Sie haben Ihre Determinante, die hat die erste Zeile, dann die J-erste Zeile, und in der J-Zeile haben Sie eine Linearkombination, Lambda aj plus Mu b, und der Rest ist wieder normal, aj plus 1 bis An. Dann können Sie das Linear auseinanderziehen.
01:02:01
Das ist die wichtige Regel, weil die Ihnen sagt, was bei dem Gausschritt, wenn Sie addieren 5 mal Zeile 3 auf Zeile 1, das ist genau so was. Zeile 1 plus 5 mal Zeile 3 ist genauso Lambda aj plus Mu mal b. Das b ist dann halt eine andere Zeile. Dann haben Sie dann Lambda aj plus Mu mal ak.
01:02:23
Das ist diese, also die Gauss-Umformung, die Standard-Gauss-Umformung addieren einer Zeile auf eine andere. Und dann sagt Ihnen die Rechenregel, das können Sie linear auseinanderziehen. Also, das gibt aj minus 1 aj aj plus 1 bis An-Determinante plus Mu mal die Determinante aj minus 1 b aj plus 1 bis An.
01:02:55
So, Linearität in jeder Zeile.
01:03:05
Das ist übrigens eine andere Methode, wie man Determinanten einführen kann. Das ist eine Abbildung von den Matrizen auf die Zahlen, die in jeder Zeile linear ist. Die Einheitsmatrix geht auf 1 und lautet so Dinge. Und dann kann man virakulös zeigen, es gibt nur eine solche Abbildung und die nennt man die Determinante.
01:03:23
Das ist relativ unkonkret, aber auch eine Möglichkeit, wie man es einführen kann. So, was haben wir jetzt noch? Ich hatte Ihnen gesagt, normalerweise wenn man Gaussschritt macht, addiert man ja zu einer Zeile das Mühlfacher einer anderen.
01:03:53
Das heißt, Sie haben genau diesen Fall von hier, nur das Lambda ist 1 und das B ist irgendein ak.
01:04:02
Das B ist irgendeine andere Zeile, ist irgendein ak. Und wenn Sie sich diesen Teil B nochmal anschauen, was dann passiert, dann haben Sie in der ersten Determinante auf der rechten Seite das Lambda ist 1. Und in der zweiten Matrix steht an der Stelle aj das ak. Das B ist ak.
01:04:20
Das ak steht jetzt, was auch immer das war, das ist einer der anderen Zeilen, steht jetzt zweimal in dieser Determinante drin. An zwei verschiedenen Zeilen, steht zweimal dieselbe Zeile. Die Matrix, die zweimal dieselbe Zeile hat, ist garantiert nicht invertierbar. Das heißt, das Ding ist 0.
01:04:42
Das Lambda ist 1, das Ding ist 0 und jetzt sehen Sie, es steht einfach die Determinante von a da. Und das ist der Inhalt von Teil C und der ist besonders toll. Also, wenn Sie sich irgendeinen Lambda aus k nehmen und macht einen normalen Gauss-Umformer, man addiert das Lambda-Fache von einer Zeile, also addiert man zu einer Zeile von a das Lambda-Fache einer anderen Zeile.
01:05:17
Das ist die Elementar-Umformung 3 vom Gauss.
01:05:21
Im Gauss hatten wir drei Umformungsmöglichkeiten, also das Vertauschen von Zeilen, Multiplizieren mit einem Lambda-Ungleich 0 und eben diese dritte. Dann ändert sich an der Determinante gar nichts. Und das ist sehr praktisch.
01:05:41
Also, wenn Sie einfach das, was man am Gauss am meisten macht, diesen Schritt, addiere 5 mal Zeile 3 zu Zeile 1 machen, dann dürfen Sie das in der Determinante problemlos machen und es passiert nichts.
01:06:00
So, ich hatte die Determinante definiert über diese abstruse Rekursion da und hatte gesagt, das nennt man Entwickeln nach der ersten Zeile. Wenn ich das Entwickeln nach der ersten Zeile nenne, dann ist zu erwarten, dass auch noch Entwickeln nach der fünften Zeile geht.
01:06:21
Und das geht auch. Ist auch nicht verblüffend, haben wir gerade gesehen, wenn Sie nämlich zwei Zeilen tauschen, dann ändert sich in der Determinante nur ein Vorzeichen. Wenn Sie also unbedingt nach der fünften Zeile entwickeln wollen, weil die so schön viele Nullen enthält, dann tauschen Sie halt erst eine fünfte Zeile, dann ist die fünfte die erste, dann können Sie nach der Formel entwickeln und dann geht das auch.
01:06:41
Oder man schreibt sich gleich die Formel hin fürs Entwickeln nach der J-Zeile. Also, Entwickeln nach der J-Zeile. Und da kommt im Prinzip die gleiche Formel raus. Hauptsächlich, wo man aufpassen muss, ist, dass man mit dem Schachbrettvorzeichen richtig agiert.
01:07:04
Also, die Determinante von A, kriegen Sie auch, wenn Sie nach der J-Zeile entwickeln, also genau wie vorne, Sie summieren K von 1 bis N. Jetzt haben Sie nicht minus 1 hoch J plus 1 plus K, sondern hoch J plus K.
01:07:20
Also die 1 hier ist das J. Dann kommt das Alpha J K. Und die Determinante von der M minus 1 Kreuz M minus 1 Matrix A J K, die Sie kriegen, indem Sie die J-Zeile und die Karte Spalte streichen. Und das, was hier steht, ist einfach der Spezialfall J gleich 1.
01:07:42
Aber weil Sie eben Zeilen vertauschen dürfen, unter Beachtung vom richtigen Minuszeichen, können Sie auch nach jeder anderen Zeile entwickeln. Jetzt kommt noch eine schöne Nachricht. Nämlich, ob Sie von der Matrix die Determinante bestimmen oder von Ihrer transponierten, ist der Determinante herzlich egal.
01:08:02
Also die Determinante von A und die Determinante von A transponiert ist gleich. Und das bedeutet auch, werde ich gleich nochmal hinschreiben, alles, was, wie ich gerade gesagt habe, Sie mit Zeilen machen können, können Sie genauso mit Spalten machen. Erst transponieren, dann werden die Spalten zu Zeilen, dann können Sie die ganzen Zeilumformungen machen und dann kriegen Sie die Determinante auch raus.
01:08:24
Und das Letzte ist, die sogenannte Multiplikativität der Determinante, auch eine wunderbare Eigenschaft, weil so überhaupt nicht offensichtlich, also wenn Sie noch eine Matrix B dazu haben, auch n Kreuz n,
01:08:41
dann können Sie A mal B berechnen. Wieder eine n Kreuz n Matrix. Und die Frage ist, was ist jetzt die Determinante vom Produkt? Und obwohl die Determinante so ein riesen langer Rattenschwanz von Summe ist, kommt tatsächlich was total Einfaches raus, nämlich Determinante von A mal Determinante von B.
01:09:04
Und das ist wunderbar. Und lassen Sie sich um Himmels willen nicht dazu verleiten, dass gleich mit Plus hinzuschreiben, das ist katastrophal falsch. Also kann man aus verschiedenen Dingen sehen,
01:09:22
aber mit Mal geht es wunderbar und mit Plus ist es einfach falsch. So, das sind die Rechenregeln, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und jetzt ziehen wir daraus nochmal explizit noch ein paar Erfolgerungen.
01:09:41
Ein, zwei davon habe ich schon gesagt. Wie gesagt, E, also A, Determinante A, das Determinante A transponiert, bedeutet, alles was in A bis D über Zeilen steht, können Sie genauso verspalten machen. Weil es der Determinante eben egal ist, ob Sie A oder A transponiert angucken.
01:10:03
Zeil und Spalten ist dasselbe. Also, das ist der erste Teil von dem 10-5. Satz 10-4, A bis D, gelten auch für Spalten statt Zeilen.
01:10:20
Äh, doch für Spalten statt Zeilen. Jetzt hatte ich Ihnen gesagt, diese ganzen Regeln da oben sagen im Wesentlichen, was passiert, wenn Sie Gaussverfahren auf die Matrix anwenden. Und die Message von dem Teil ist, Sie dürfen, wenn Sie Determinanten bestimmen wollen, nicht nur mit den Zeilen Gauss machen, sondern sogar auch mit den Spalten.
01:10:42
Und Sie dürfen das Wild miteinander mischen. Also, wenn Sie eine AGS machen, wurschteln Sie bitte nicht an den Spalten rum. Aber wenn Sie eine Determinante ausrechnen, dürfen Sie Wild, Spalten und Zeilen mischen. Und das ist manchmal sehr hilfreich, nach einem Beispiel. Ähm, ich will Ihnen, wenn Sie jetzt noch mit Spalten arbeiten,
01:11:03
haben Sie natürlich auch die Entwicklung nach den entsprechenden Spalten. Also schreibe ich Ihnen nochmal die Formel für die Entwicklung nach der Kartenspalte hin. Könnte man auch alles als Definition der Determinante nehmen. Dass ich die erste Zeile genommen habe, war reine Willkür.
01:11:23
Also, Entwicklung nach der Kartenspalte, Determinante von A ist gleich. Sie summieren jetzt wieder von 1 bis N über J. Sie summieren jetzt über die Zeilen. Also, Sie gehen die Kartenspalte runter, kriegen die Vorzeichen, die wechselnden, minus 1 hoch J plus K, jeweils den Eintrag an der J-Kartenstelle,
01:11:42
also in der J-Zeile und Kartenspalte. Und wenn Sie den Eintrag an der J-Zeile und Kartenspalte haben, müssen Sie die J-Zeile und die Kartenspalte streichen. Und kriegen die Determinante eben, die Sie kriegen, aus dem A, wenn Sie die J-Zeile und die Kartenspalte streichen. So, und was anderes.
01:12:03
Der letzte Gauss-Umformungsschritt, den wir noch nicht behandelt haben, ist Multiplizieren einer Zeile mit Lambda. Was passiert, wenn Sie eine Zeile einfach mit Lambda multiplizieren? Dann passiert beim Gauss in der Lösungsmenge nichts.
01:12:22
Und, es sei denn Lambda ist Null, das dürfen Sie beim Gauss nicht machen. Aber wenn Sie irgendeinen Lambda-Ungleich Null dran multiplizieren, ändert sich an der Lösungsmenge nichts. Die Determinante ändert sich. Achtung. Haben wir im Prinzip vorhin schon gesehen. Das ist ein Spezialfall der Linearkombination.
01:12:42
Wenn Sie eine Zeile mit Lambda multiplizieren, dann ist die Determinante Lambda mal so viel. Und um was wir uns jetzt noch kümmern wollen, hier ist die Frage, was passiert, wenn Sie die ganze Matrix mit Lambda multiplizieren? Und das ist etwas, wo man oft Fehler macht.
01:13:07
Deswegen noch mal explizit. Weil es so danach schreit, zu sagen, der Determinante von Lambda A ist Lambda mal Determinante von A. Nein. Weil, was ist Lambda mal A? Lambda mal A bedeutet, Sie multiplizieren jeden Eintrag in A mit Lambda.
01:13:25
Das heißt, Sie multiplizieren jede Zeile mit Lambda. Wenn Sie eine Zeile mit Lambda multiplizieren, dann wird die Determinante mit Lambda multipliziert. Das heißt, wenn Sie jede Zeile mit Lambda multiplizieren, dann müssen Sie die Determinante mit Lambda hoch N multiplizieren.
01:13:41
Also, die Determinante von Lambda A ist Lambda hoch N, Determinante von A. Das heißt, die schöne Formel mit Lambda mal gilt nur für eins Kreuz eins Matrizen. Und mit denen hat man nicht so oft zu tun. Oder sehr oft zu tun, aber dann nennt man sie nicht Matrizen. So.
01:14:02
Damit haben wir jetzt nur diesen Satz Rechenregeln für Determinanten und Mengen. Ich mache gleich zwei Beispiele, an denen Sie sehen. An denen kommen die auch alle nochmal. Aber was hier sozusagen das Wichtige ist, hatte ich vorhin schon gesagt, will ich noch mal festhalten. Sämtliche Gauss-Elementarumformungen können Sie jetzt auf Determinanten loslassen,
01:14:25
um die zu vereinfachen. Wenn Sie den normalen Gausschritt machen, addieren als Vielfachen einer Zeile auf eine andere, passiert gar nichts mit der Determinante. Wenn Sie zwei Zeilen tauschen, kriegen Sie ein Minuszeichen. Wenn Sie Zeile mit Lambda multiplizieren,
01:14:43
multipliziert sich die Determinante mit Lambda. Also Sie wissen, was passiert. Und das Ziel muss immer sein, wenn Sie jetzt eine komplizierte Matrix haben und machen diese Gausschritte, dann ist Ihr Ziel natürlich, eine untere oder obere Dreiecksmatrix zu produzieren,
01:15:00
weil von der ist die Determinante leicht. Von der ist die Determinante einfach Produkt der Diagonalelemente. So, machen wir Beispiele. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, wenn ich Ihnen jetzt eine große Matrix hinschreibe, dann ist das furchtbar.
01:15:21
Wenn wir das über die Definition machen müssen. Also bringe ich Ihnen meine relativ große Matrix und zeige, dass das mit den Rechenregeln auch nicht hübsch, aber immerhin machbar ist. Also eine 5 Kreuz 5. 1 minus 2, 3, 5, 8. 0 minus 1, minus 1, 2, 3.
01:15:43
2, 4, minus 1, 3, 1. 0, 0, 5, 0, 0. 1, 3, 0, 4, minus 1. Sieht hübsch aus. Sorgt normalerweise für den sofortigen Fluchtreflex, wo ist mein Rechner,
01:16:02
das haue ich in Maple oder Mathematika oder sonst was. Nein, aber das kann man noch echt von Hand, obwohl sie so furchtbar groß aussieht. Und ich habe Ihnen jetzt eben eine Viertelstunde lang erzählt, was man alles mit Determinanten machen kann. Und das ist zum einen natürlich viel und erst mal verwirrend, aber es bedeutet zum anderen, sie haben wahnsinnig viele Möglichkeiten.
01:16:23
Und wenn man wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, dann gibt es meistens ein paar, die sehr schnell zum Ziel führen und ein paar, die einen im Kreis jagen. Und die Message ist, man kann bei dieser Determinantenberechnerei sehr geschickt vorgehen und hat wenig Arbeit. Oder man kann brute force vorgehen und hat, wenn es dumm läuft,
01:16:41
ziemlich viel Arbeit und es lohnt sich gerade beim Determinantenberechnen nicht gleich loszurechnen, sondern nochmal kurz drauf zu gucken. Kurz drauf zu gucken, ob die Matrix nicht irgendwas Schönes hat, was die Determinantenberechnung einfach macht. Also zum Beispiel bei diesem Beispiel, um Himmels willen nicht jetzt nach Definition, nach der ersten Zeile entwickeln. Warum? Die erste Zeile ist voll besetzt.
01:17:04
Es gibt eine Summe von 5, 4 x 4 Determinanten. Schauen Sie sich mal lieber die vierte Zeile an. Die vierte Zeile enthält genau einen Eintrag, der nicht Null ist. Das heißt, wenn ich nach der entwickle, dann kriege ich eine Summe mit einem, mit einer 4 x 4 Determinante.
01:17:23
Arbeit geviertelt. Was man jetzt tun müsste, ist entweder Zeile tauschen mit der ersten und dann nach der ersten entwickeln nach Definition. Oder die Rechenregeln jetzt gerade aus dem Satz anwenden, und sie dürfen auch direkt nach der vierten Zeile entwickeln.
01:17:40
Die dürfen direkt nach der vierten Zeile entwickeln. Das machen wir jetzt auch. Das war 10, 4d. Also wir entwickeln nach dieser Zeile hier. 10, 4d sagt, was dann rauskommt. Im Prinzip kommt genau diese Formel raus, wo an der Stelle 1 halt jetzt 4 steht. Überall da, wo in dieser Formel,
01:18:01
nicht überall, wo dann der 1 steht. Die 1 an der Summe bleibt stehen. Aber die anderen drei, und die minus 1 bleibt auch eine minus 1. Aber die 1 im Exponenten, die 1 unten am Alpha und die 1 im a1k werden 4. Und dann kriegt man was raus. Wir müssen erstmal uns um das wechselnde Vorzeichen kümmern.
01:18:23
Dafür ist das Schachbrett wieder gut. Also wie gesagt, oben rechts ist immer Plus. Dann ist hier Minus, Plus, Minus, Plus, Minus. Also kriegen wir ein negatives Vorzeichen. Wir kriegen minus 5 mal die Determinante, die Sie kriegen, wenn Sie die vierte Zeile und die dritte Spalte streichen.
01:18:41
Also 1, minus 2, 5, 8. 0, minus 1, 2, 3. 2, 4, 3, 1. Und 1, 3, 4, minus 1. So, jetzt guckt mal drauf und stellt fest, dass so viele Nullen haben wir jetzt nicht mehr.
01:19:01
Also dieser schöne Teil, mal einfach alles, alles wo nur Nullen stehen, rauszuentwickeln, der ist weg. Jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Uns fehlen Nullen. Alte Mathematiker-Weisheit haste keine, machte welche. Wenn keine Nullen da sind, müssen wir Nullen produzieren.
01:19:22
Das machen wir mit Gauss. Also zum Beispiel wollen wir in der ersten Spalte nur, in der ersten Spalte sehen wir hinten schon mal nur eine Null. Dann machen wir noch ein paar Nullen dazu. Was dürfen wir machen? Wir dürfen das Minus zweifacher der letzten Zeile auf die dritte addieren und wir dürfen das Minus einsfacher der letzten Zeile auf die erste addieren. Dabei ändert sich an der Determinante gar nichts.
01:19:43
Standard-Gausschritt ändert die Determinante nicht. Also bleibt hier übrig 0. Minus zwei, minus drei ist minus fünf. Fünf minus vier ist eins, acht und eins ist neun. Die Zeile bleibt. Null minus eins, zwei, drei. Das ist eine Null, so war es gemacht.
01:20:01
Vier minus sechs ist minus zwei. Drei minus acht ist minus fünf. Eins und zwei ist drei. Eins, drei, vier, minus eins. Das war ein Gausschritt. Jetzt haben wir wieder den wunderschönen Effekt, dass wir wunderbar entwickeln können, nämlich nach der ersten Spalte.
01:20:23
Wir entwickeln nach der ersten Spalte. Alles, was wir mit Zeilen dürfen, dürfen wir auch mit Spalten. Entweder gehen sie zur transponierten über oder sie machen es direkt. Also was brauchen wir, um nach der ersten Spalte zu entwickeln? Wir brauchen erst mal das Vorzeichen von dem blöden Element da unten. Also plus, minus, plus, minus ist wieder ein Minuselement.
01:20:43
Nach Schachbrett. Also kriegen wir minus fünf mal minus. Also plus fünf. Mal die Determinante, die Sie erhalten, wenn Sie die erste Spalte und die letzte Zeile streichen. Also bleibt noch ein Dreikreuz, drei Determinante übrig. Minus fünf, eins, neun.
01:21:01
Minus eins, zwei, drei. Minus zwei, fünf, drei. Jetzt gibt es gar keine Null mehr. Wie ärgerlich. Also guckt mal nochmal drüber, was man so machen kann. Man kann erst mal, damit wir es auch mal gemacht haben,
01:21:25
sehen, in der letzten Spalte stehen nur Vielfache von drei. Also dividieren wir da mal eine drei raus. Diese drei ziehen wir vor. Die Determinante ist linear in jeder Zeile.
01:21:42
Determinante von A gleich Determinante von A transponiert. Also Determinante ist linear in jeder Spalte. Also können Sie die drei einfach vorziehen. Und es kommt raus fünf mal drei. Mal die Determinante, die Sie kriegen, wenn Sie da hinten durch drei teilen.
01:22:03
So. Dann sind schon mal die Zahlen kleiner. Und jetzt können wir uns ein bisschen aussuchen, welche Spalte, ja. Nein, weil Sie haben nach der eins und links entwickelt.
01:22:21
Also nach der ersten Spalte entwickelt. Das gibt plus eins mal null mal die Determinante, minus eins mal null mal die Determinante und am Schluss minus eins mal eins mal die Determinante, die übrig bleibt. Diese eins steht auf einem Negativfeld vom Schachbrett. Also das ist dieses minus eins hoch j plus k, was da steht.
01:22:44
In der Matrix habe ich da irgendwo eine minus dritte, eine zweite Spalte. Ja, die ist eine minus fünf. Danke. Ich wundere mich schon seit längerem, wie ich durch das Gauss- und Determinantenkapitel komme, ohne hier dauernd mich peinlich zu verrechnen.
01:23:02
Das muss ja passieren. Gut. Danke. So, jetzt können wir uns aussuchen, welche Zeile oder Spalte wir jetzt hier aufräumen. Mein Vorschlag ist, wir nehmen die letzte Spalte, also die letzte Zeile von der zweiten abziehen,
01:23:22
letzte Zeile mit minus drei multiplizieren und zur ersten dazuzählen. Wenn Sie das machen, ändert sich an der Determinante nichts, weil dieser Gauss-Schritt an der Determinante nichts ändert. Wir müssen nur wieder konzentriert rechnen. Also, minus fünf plus sechs ist eins. Eins plus fünfzehn ist sechzehn.
01:23:43
Drei minus drei ist null. Minus eins plus zwei ist eins. Zwei plus fünf ist drei. Und eins minus eins ist null. Minus zwei minus fünf eins. So, ich hoffe, ich habe keinen neuen Unfug produziert.
01:24:02
Jetzt entwickeln wir wieder nach der letzten Spalte. Es gibt fünfzehn mal, was ist das Vorzeichen von dem Element da unten? Das Erste oben links ist immer ein Plus-Element, dann ist das Minus und das Plus, Minus, Plus. Also, das hat ein Plus-Vorzeichen.
01:24:27
Zwei plus fünf ist nicht drei. Wo sind Sie denn? Da. Zwei plus fünf ist nicht drei, sondern sieben, ja? Na ja. Danke. Ja, ja. Dieses Gausszeug ist, wie gesagt, Konzentrationsarbeit.
01:24:45
Das geht nicht nur Ihnen so, sondern mir auch. Gut. Also, wir entwickeln nach diesem Element da. Es gibt fünfzehn mal eins mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn Sie die letzte Zeile und die letzte Spalte streichen. Jetzt sind wir gleich durch. Eins, sechzehn, eins, sieben.
01:25:01
Und die können wir jetzt nach unserer bekannten Formel ausrechnen. Das ist fünfzehn mal sieben minus sechzehn. Sieben minus sechzehn ist minus neun. Nein, doch, minus neun. Also, minus fünfzehn mal neun. Minus 150 minus 135.
01:25:21
Gut. Damit haben wir die Determinante gekillt. Und Sie sehen, es ist mühsam, aber machbar. Und was Sie sehen, wenn Sie mal selber an so was rumbasteln, es ist sehr entscheidend, dass man das Richtige tut
01:25:42
und nicht brute force in der Landschaft rumrechnet, weil dann kann es sehr, sehr eklig werden. So. Ja, ja, ich weiß. Es ist gleich Probeklausur und Sie wollen schnell weg.
01:26:01
Ich will Ihnen... Doch, doch, den B-Teil packe ich noch. Der geht schnell. Der geht schnell, obwohl er unübersichtlich aussieht. Okay, Sie haben Glück, jetzt verlässt mich die Mine.
01:26:22
Also, dann haben Sie jetzt Ruhe, zur Probeklausur zu gehen. Viel Erfolg für die, die heute dran sind und bis Freitag.