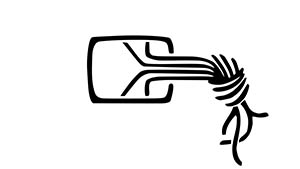Court in the Akten
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Formal Metadata
| Title |
| |
| Subtitle |
| |
| Title of Series | ||
| Number of Parts | 165 | |
| Author | ||
| License | CC Attribution 4.0 International: You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor. | |
| Identifiers | 10.5446/39330 (DOI) | |
| Publisher | ||
| Release Date | ||
| Language |
Content Metadata
| Subject Area | ||
| Genre | ||
| Abstract |
| |
| Keywords |
35C3 Refreshing Memories11 / 165
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
22
26
29
30
31
33
37
38
39
40
44
45
48
49
53
54
55
57
59
60
62
65
66
69
70
72
73
74
77
80
82
83
84
85
86
87
89
92
94
100
104
105
106
107
108
111
113
114
115
116
117
119
121
122
123
124
127
132
133
136
139
141
143
144
145
146
148
149
150
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
00:00
Lecture/Conference
00:42
AlgorithmPhysical lawLecture/Conference
01:20
Meeting/InterviewJSONComputer animation
01:56
Physical lawMeeting/InterviewLecture/Conference
02:35
InformationXMLUMLMeeting/Interview
03:12
Meeting/Interview
03:51
BlogAlgorithmXMLUMLMeeting/Interview
04:34
SmartphoneAlgorithmSoftwareMeeting/InterviewComputer animationXML
05:09
Focus (optics)WebsiteLecture/ConferenceMeeting/InterviewComputer animation
05:49
NeWSMeeting/InterviewComputer animation
06:32
Weight functionMeeting/Interview
07:07
Energy levelComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
07:48
Hausdorff spaceMobile appData qualitySample (statistics)Durchschnitt <Mengenlehre>Computer animationJSONXMLLecture/ConferenceMeeting/Interview
09:06
Row (database)Meeting/Interview
09:49
Version <Informatik>SPARK <Programmiersprache>LengthProbability distributionStrich <Typographie>Computer animationTableXMLEngineering drawingDiagramProgram flowchart
11:24
Version <Informatik>ZahlVersion <Informatik>Meeting/InterviewJSONXMLComputer animation
12:09
BerechnungChain ruleMeeting/Interview
13:35
Variable (mathematics)Stress (mechanics)JSONXMLMeeting/InterviewComputer animationDiagram
14:22
ZahlDiagram
14:56
Propositional formulaWeight functionComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
15:39
AlgorithmWeight functionBerechnungXMLComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
16:13
CodeHausdorff spaceJSONXMLComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
16:44
Weight functionWeightComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
17:22
Slide ruleComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
18:01
Energy levelMeeting/Interview
18:33
Menu (computing)InternetComputer wormPhysical lawInternetUniform resource locatorVersion <Informatik>Lecture/ConferenceMeeting/InterviewXML
19:20
ForceGit <Software>ForceMeeting/InterviewComputer animationDiagram
20:29
Blu-ray DiscPhysical lawMeeting/InterviewComputer animation
21:06
LebensdauerGenderPhysical lawPatch (Unix)Computer animationMeeting/Interview
21:47
Lebensdauer6 (number)GenderComputer animation
22:19
LebensdauerTrans-European NetworksPhysical lawInternetLecture/ConferenceComputer animationXMLProgram flowchart
22:51
Web pagePhysical lawExpressionComputer animationMeeting/Interview
23:24
World Wide WebACIDEmailOptical character recognitionPDF <Dateiformat>Version <Informatik>Version <Informatik>XMLProgram flowchartComputer animationMeeting/Interview
24:06
Optical character recognitionPDF <Dateiformat>Version <Informatik>Optical character recognitionPasswordMeeting/InterviewXMLComputer animation
25:05
PDF <Dateiformat>Computer fileZugriffNewsletterEmailLecture/ConferenceMeeting/InterviewXMLUMLProgram flowchart
25:48
AgreeablenessLaufzeitMeeting/InterviewXML
26:22
ForceLINUXPhysical lawPositionMeeting/InterviewXML
27:06
CountingForceInterface (computing)InternetPhysical lawPDF <Dateiformat>Version <Informatik>Meeting/InterviewComputer animation
27:59
Staff (military)RSS <Informatik>Function (mathematics)APIComputer animationMeeting/Interview
28:39
HEPForceComputer animationLecture/ConferenceMeeting/Interview
29:27
Physical lawMetadataComputer animationMeeting/Interview
30:20
Physical lawLecture/ConferenceMeeting/Interview
30:54
XMLMeeting/Interview
31:30
Lecture/Conference
32:11
XMLLecture/ConferenceMeeting/Interview
32:43
Email
33:18
Meeting/InterviewLecture/Conference
33:57
Set (mathematics)Block (periodic table)Meeting/InterviewLecture/Conference
34:56
AlgorithmUploadingMeeting/InterviewLecture/Conference
35:35
Row (database)Meeting/Interview
36:06
Stylus (computing)Patch (Unix)CodeDatenformatVersion <Informatik>Plug-in (computing)Hacker (term)Lecture/ConferenceXMLMeeting/Interview
38:45
Physical lawSupremumOptical character recognitionLecture/ConferenceXMLMeeting/Interview
39:20
Grand Unified TheoryLightning <Programm>Lecture/ConferenceXMLMeeting/Interview
40:00
Magnetic stripe cardSupremumLecture/ConferenceSource code
Transcript: German(auto-generated)
00:18
Deshalb kommen wir zu einem der Talks, auf die ich mich am meisten freue, weil ich beide
00:23
diese Projekte im letzten Jahr extrem gefeiert habe. Zum einen, wer von euch hat was von Open Schufa mitbekommen? Deshalb seid ihr hier, richtig, fast alle. Wer von euch hat denn mitgemacht bei Open Schufa?
00:40
Immerhin, ein paar Leute hier im Saal, finde ich total großartig. Vielleicht können wir diesen verdammten Algorithmus mal reverse-ingenieren. Arne ist ja dran mit seinen Leuten und das Zweite, was ich richtig gefeiert habe, waren die offenen Gesetze. Plötzlich ist da ein Portal, wo alle Gesetze drin sind und genau so fand ich das.
01:10
Also, machen wir es schnell jetzt. Der nächste Talk, Cort in die Akten von Stefan Wehrmeier, Walter Palmizhofer und Arne Semsroth. Einen großen Applaus.
01:27
Ja, guten Morgen. Schön, dass so viele Leute so früh am Morgen hergekommen sind zu unserem Talk Cort in die Akten. Ein Talktitel, den ich super lustig finde, aber ich glaube, da bin ich der Einzige zumindest auf dem Panel.
01:42
Einer, noch jemand, finde ich lustig. Egal, wir machen einen kleinen Talk zur angewandten Hacker-Ethik, vor allem über den Einsatz daraus, nämlich öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und wir haben zwei Projekte mitgebracht, die, glaube ich, in sehr
02:01
unterschiedlicher Art damit umgehen, die beide mit privaten Unternehmen zu tun haben, die sich aber verhalten, als ob sie Behörden werden, zumindest in bestimmten Teilen, nicht in dem Teil, wo es um Transparenz geht, aber in den anderen Teilen. Und wir haben zwei unterschiedliche Rangehensweisen versucht, um diese beiden
02:23
Unternehmen zu knacken. Und wir fangen an mit Open Schufa. Und danach geht es um offene Gesetze. Und danach haben wir hoffentlich ein bisschen Zeit, um noch drüber zu quatschen und zu diskutieren. Offene Daten bei der Schufa sind natürlich ein sehr sensibles Thema. Private Daten schützen und öffentliche Daten nützen, das beides kommt,
02:42
glaube ich, sehr, sehr interessant zusammen bei der Schufa. Die Schufa hat Daten über fast 70 Millionen Leute in Deutschland und hat Daten zu sehr sensiblen Informationen, natürlich Finanzinformationen dann vor allem, Kreditausfälle, solche Sachen über sehr viele Menschen,
03:02
wahrscheinlich die meisten Menschen hier im Saal. Und ganz viele Menschen, die nicht so viel mit der Schufa zu tun haben, denken tatsächlich, dass die Schufa eine Behörde sei. Aber die Schufa ist ein Unternehmen. Dass auch die Berechnungsmethoden von den sogenannten Schufa-Scores nicht offenliegt. Also man man redet ja so von den Schufa-Scores, die die
03:24
Wahrscheinlichkeit berechnen sollen, zumindest nach der jemand einer Kreditforderung nachkommt oder nicht. Und es gibt tatsächlich nicht nur ein Schufa-Score pro Person. Es gibt sehr viele, knapp 16 Scores, die die Schufa pro Person berechnet.
03:40
Und wie sie aber auf diese Scores kommt, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das ist auch schon gerichtlich so festgestellt worden vom Bundesgerichtshof. Die Schufa muss diese Berechnungsmethoden hinter diesem Score nicht offenlegen. Was die Schufa nicht verhindern kann, ist, dass Leute diesen Schufa-Score reverse engineern. Das ist nämlich legal. Und das haben wir versucht mit Open Schufa.
04:03
Open Schufa ist ein gemeinsames Projekt von der Open Knowledge Foundation und Algorithm Watch. Und die Idee dahinter ist, diesen Schufa-Score, diese Berechnungsmethode zu reverse engineern. Wir haben im Frühjahr dazu ein Crowdfunding gemacht. Viele von euch haben da Geld für gespendet.
04:21
Wir danken euch sehr herzlich dafür. Das hat es uns ermöglicht, mit dieser Arbeit anzufangen. Wir hatten ein Werbevideo dafür, haben dafür Nico Semsrott gewinnen können. Sehr sympathischer Kerl. Super Video auch. Und die Idee von Open Schufa war oder ist auch weiterhin, dass alle Menschen eine Selbstauskunft
04:41
net anbieten können, die über sich nach der DSGVO beziehungsweise davor nach dem Bundesdatenschutzgesetz anfragen können, die dann per Post bekommen und über eine App, die wir entwickelt haben, die dann einscannen, anonymisieren oder pseudonymisieren können und uns wiederum dann spenden können. Das haben auch ziemlich viele Leute gemacht, über Selbstauskunft
05:02
net erst einmal ihre Selbstauskunft angefragt und uns das dann gespendet. Wie waren erst einmal so die Reaktionen darauf? Die Schufa war nicht so fröhlich über dieses Projekt. Die haben gleich zu Beginn dieses Crowdfundings einen großen Banner auf ihre Website gestellt und haben gesagt,
05:20
der Open Schufa Kampagne ist irrenführend und gegen Sicherheit und Datenschutz in Deutschland. Und das war super. Das war vielen Dank an die Schufa dafür. Die Schufa hat nämlich auf ihrer Startseite auf schufa.de ein Riesenbanner Open Schufa gehabt.
05:41
Deswegen, um darauf zu linken. Und das hat uns nochmal ganz schön viel Traffic gebracht. Das war super. Überhaupt hat sich die Schufa in diesem ganzen Prozess sehr, sehr kooperationsunwillig gezeigt. Es gab ziemlich viele Journalistinnen, die versucht haben, zu recherchieren, einzelne Fällen hinterher zu gehen und dann die Schufa damit zu konfrontieren.
06:02
Und hier zum Beispiel ein Bericht von einem Journalisten der Welt, der ziemlich eindrücklich bewiesen hat, wie denn die Schufa mit Journalisten umgeht. Die machen wirklich in so gut wie jedem Fall, wo Journalisten versuchen, über sie Berichterstattung zu machen,
06:20
Massivdruck. Die versuchen im letzten, in der letzten Sekunde Berichterstattung zu verhindern. Die kommen mit solchen Fake News Vorwürfen und so ein Zeug und insofern zeigt sich, glaube ich, allein dadurch schon ganz gut, dass die Schufa da einiges zu verbergen hat und was wir da ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen konnten. Das erzählt Walter.
06:42
Ja, hallo. Wir haben im Februar aufgerufen, dass die Daten angefragt werden und haben im Mai angefangen, die Daten dann zu sammeln und jetzt noch mal zurückkommen auf das größere Thema mit private Datenschützen, öffentliche Nützen. Hier braucht es quasi private Daten, dass man die Daten, die öffentlich sein sollten und dass
07:01
aus unserer Sicht dieses Scoring und die Gewichtung nachgebaut werden kann, damit man das dann rausfindet. Und das war jetzt insgesamt gab es 100.000 Anfragen an so Auskunftsdateien. Das war jetzt nicht nur die Schufa. Wir haben mit der Schufa angefangen und das bedone ich immer wieder, weil das die bekannteste Marke ist oder Unternehmen in dem Bereich und es sehr wohl andere Unternehmen gibt, die noch schlechtere Daten verwenden
07:21
oder noch kaputtere Scoring-Mechanismen haben, die noch weniger bekannt sind. Und wir sagen immer, wir fangen mit der Schufa an, hören aber da nicht auf. Und jetzt noch mal das, das ist das Schöne, was in anderen Ländern heißt, das ist der MyData. Wir möchten sie ja OurData nennen, wo wir dann, wenn man sich bewusst ist, was die Daten sind, spenden kann, damit man in diesem Datenpool was für die
07:41
Gemeinschaft rausfinden kann. Und das ist der Übergang von privaten zu öffentlichen Daten. Und so haben wir dann im Laufe von einem halben Jahr circa 3000 Schufa Datenspenden bekommen. Da gab es dann kleine Probleme mit denen und zwar wir hatten einen Medienbruch. Das heißt, wenn die Leute angefragt haben bei der Schufa, haben sie die Auskunft per Post nach Hause geschickt
08:02
bekommen und mussten die dann mit unserer App digitalisieren, einscannen, schwärzen, wenn sie es wollten und dagegen gewisse Daten Qualität verloren, weil teilweise das Licht schlecht war, Ausdruck, bla bla bla. Und das war der erste Fall, da hat man einen Medienbruch und dann hat man einen Datenbruch. Deine Datenbruch war ganz einfach,
08:20
dass die Leute, die mitgemacht haben, quasi so ein besserer demografischer Durchschnitt war als unser Panel hier. Also es waren 85 Prozent Männer. Es waren auch der Altersdurchschnitt eher jung und urban und tech- affin. Das heißt, da hat man dann das Sample nicht perfekt gehabt.
08:41
Und das andere war am 25. Mai dieses Jahres gab es die DSGVO. Ab dem Zeitpunkt gab die Schufa dann weniger Daten hier. Das ist relativ witzig in dem Sinn, wenn es ein Unternehmen in Deutschland geben hätte sollen, dass sich auf die DSGVO vorbereiten hätte sollen, sollte wäre es wahrscheinlich dieses Unternehmen gewesen, oder?
09:01
Das ist eins der großen Unternehmen, die persönliche Daten haben und die haben es quasi verpeilt, wie der Schreinermeister von Nehmann, der sich denkt, der muss sich die Weihnachtspostkarte überlegen, was er rausschicken kann. Das lag auch daran, dass eigentlich der hessische Datenschutzbeauftragte da zu wenig nachgegangen ist, aus unserer Sicht. Das heißt, die Schufa hatte da circa sieben Monate lang jetzt mal einen Freilauf, Daten nicht
09:22
zu liefern, die sie eigentlich liefern hätten sollen. Das war ein Problem, wieso wir weniger Datenspenden hatten oder von diesen 3000 nicht alle verwenden konnten. Und das ist quasi jetzt das Datensample, über was wir jetzt sprechen. Das heißt, das ist nicht wirklich repräsentativ und das ursprüngliche Ziel, dass wir 5000 perfekte Datensätze hätten, wo wir dann das wirklich schön
09:40
nachrechnen könnten, mit einem nachmodellierten Schufa-Modell. Das sehen wir noch nicht, aber wir haben ein paar lustige Findings in den Daten gefunden. Das war jetzt mal so, wie die Auskunft war vor der DSGVO. Das war relativ übersichtlich. Da sieht man auch verschiedene Branchen-Scores und das war dann ab dem 25. Mai. Das war eher mager.
10:01
Wir haben sie dann mal die Daten angeschaut und der erste Schritt war, was sind die harten Faktoren, die da reinkommen? Und da sieht man jetzt, das sind dann mal so Variablen, wo man dachte, die könnten zutreffen. Da sind jetzt zwei Ausreißer dabei, die möchte ich kurz näher zeigen. Das eine ist halt Insolvenzverfahren und das zweite ist Zwangsveränderungen. Das ist, die haben einen relativ harten Einfluss. Das ist eine logarithmetische
10:21
Skala. Das heißt, oben ist unten ist Null und das zweite Strich unter Null ist dann bei 90. Das heißt, wenn es runter geht, geht es wirklich runter. Das sind jetzt Scores, die, wo man darüber diskutieren kann, für Kreditwürdigkeit, wo die Sinn machen. Wir haben das Problem an sich, 95 Prozent vom Score
10:40
erreichen circa drei Viertel der Leute und in diesem fünf Bereich von den Scores oder für 75 Prozent der Leute wird dann halt entschieden, bekommt man Mietvertrag oder bekommt man Handyvertrag, obwohl das Score relativ hoch ist und die Variablen, die dafür herangezogen wären, um diese Feinheiten zu berechnen, sind relativ aus unserer Sicht A-schwammig, beziehungsweise
11:01
wir haben oft gesagt, dass der Datenfehler wahrscheinlich drinnen sind. Ein Fall war zum Beispiel, es gibt schlechte Scores ohne Negativmerkmale. Das betraf jetzt zum Beispiel 20 Leute, die überhaupt keinen Negativ-Eintrag hatten und einen Negativ-Score bekommen. Hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung betrifft würde das circa 100.000 Leute betreffen. Und die Sache ist, wenn man
11:20
selber nie Probleme gehabt hat mit einer Finanzierung oder Zurückzahlung, dann würde man auch nie daran denken, dass man in dem System drinnen ist, weil man denkt, man hat ja immer alles richtig gemacht. Und das ist jetzt 100.000. Aus meiner Sicht ist das relativ eine hohe Zahl. Nächster Schritt wäre, es gibt angeblich genauer Scores ohne Daten, das heißt 75 Prozent der Leute haben
11:42
weniger als drei Datenmerkmale. Das ist jetzt für eben, ob man Mietwohnung bekommt oder nicht, eine relativ dünne Suppe, würde ich mal sagen. Und ein dritten Teil war noch, es gibt verschiedene Versionen von Scores. Das heißt, es gibt dann Bankenscore, da gibt es eine Version eins, da gibt es eine Version zwei, da gibt es eine
12:00
Version drei. Man weiß nicht, welche Banken genau welche Scorevariante anfragen und was das dann auch bedeutet. Es gibt dann quasi Diskriminierung zwischen den verschiedenen Scorewerten. Und aus meiner Sicht, diese Scoreversionen zeigen auch schön auf, was im Hintergrund passiert. Also es gibt Unternehmen, die quasi die Daten, die zur Bewertung verwendet werden, dann mal einsammeln, diese
12:21
dann der Schufa übermitteln. Die stülpt dann ihr nicht offizielles Modell drauf und dann verwendet jemand ein Dritter, der sagt, ja, da ist das Score, deswegen kriegst du A oder B nicht. Und das ist quasi so eine Kette, die halt intransparent ist. Und jeder in der Kette sagt, der erste sagt, ja, ich sammle ja nur die Daten, ich mache gar nichts damit. Der zweite sagt, ja, ihr habt die Daten von dem bekommen, berechnet dann.
12:40
Das geht mir aber nicht zu, wie das berechnet ist. Und der dritte sagt, ja, ich habe nichts berechnet, ich behalte mir nur die Berechnung und bewerte dann, ob der Konsument oder die Konsumentin das Produkt haben kann. Und das ist ein der riesengroßen Probleme, wenn der Kette auch Fehler passieren. Ein Beispiel ist jemand bezahlt den Kredit zurück und dann, nachdem er den Kredit zeitgemäß und ohne
13:00
Probleme zurückbezahlt hat, die Zurückbezahlung in dieser Kette nicht reportet wird. Wenn die Person dann das nächste Mal, wenn ein Kredit dann fragt, dann sagt das System Hey, Alter, du hast ja nur ein Kredit laufen. Deswegen kriegst du eine negative Bewertung, weil du schon laufen hast und keiner in der Kette ist zuständig und keiner, der sich informieren möchte, hat einen Zugriff, dass er nachvollziehen kann, was für Daten sind, die sich
13:20
abgespeichert. Das ist einer der großen Kreditpunkte, dass man dann bezahlen muss für das, dass man reinschauen müsste, dass man negativ bewertet wird, wer irgendeiner in der Kette am Bock geschossen hat. Das ist im Prinzip eine Art von Wegelagerei aus meiner Sicht. Dann haben wir noch zum Beispiel die Variablen Alter, Geschlecht und Umzüge war spannend. Bei Alter und Geschlecht gibt es einen Hinweis darauf,
13:41
dass es Diskriminierung gibt, wo Leute auch nichts dafür können, dass sie A, jung sind oder B, männlich. Und eine spannende Sache waren Umzüge, weil die negativ einwirken. Also die Anzahl der Umzüge kann man sich anschauen. Das ist die Grafik. Je öfter man umzieht, desto geht es runter. Und da gibt es einen Unterschied, ob ich umziehen muss, weil ich quasi von
14:00
Problemen davon laufe oder weil ich einen Vertreterjob habe, wo ich quasi meine Firma mir nötigt, dass ich halt alle drei Monate quasi in einem anderen Bundesland bin. Und die Person, die jetzt Vertreter war, kann sich aber nicht dagegen wehren und sagen, Alter, meine Umzüge sind quasi gerechtfertigt, weil ich nach Bayern muss oder was auch immer. Da hatte ich schon selber Pech.
14:24
Und dann eins der schönsten Findings war noch. Wir sehen hier drei Muster und das ist auf der einen Seite die Anzahl der Kreditkarten, die Anzahl der Bankkonten und dann die Anzahl der Mobil-Funk-Verträge. Und wir sehen hier sehr schön überall der Peak, also der beste Score ist
14:41
bei der Zahl zwei. Das heißt, wenn man zwei Kreditkarten hat, zwei Bankverbindungen und zwei Handyverträge, dann ist der Score wahrscheinlich am höchsten. Jetzt würde ich natürlich nie sagen, dass man den Score so geben könnte, weil das würde in dem Raum ja auch keiner machen. Aber man könnte sagen, zwei ist besser als eins. Das Gleiche wäre jetzt aber, wenn umziehen, sollte man halt schauen, dass man, wenn man nur
15:00
temporär wohin sitzt, das vielleicht auch nicht meldet, sondern das ignoriert. Ein anderes Trick wäre noch, wenn man halt ein Kind hat, ist das anscheinend positiver. Das dauert natürlich meistens, vielleicht hilft da dann auch die Adaption, wenn es schnell gehen muss. Nebenbei gab es seit dem 30. Oktober eine Vorstellung von einer Studie, verbrauchergerechtes Scoring vom Sachverständigenrat des
15:23
Justizministeriums. Das ist insofern interessant, wie die relativ klare Aussage gemacht haben, dass eigentlich die Kriterien, die Gewichtung offen gelegt werden sollten, dass auch das Ministerium das eigentlich dafür zuständig ist. Und es gab harte Aussagen dazu, die dann nur verstärkt worden sind durch die Beöffentlichung vom
15:41
Bayerischen Rundfunk und Spiegel Online, das am 28. November rausgekommen ist. Die haben die Datenanlöse publiziert und das war relativ gutes Medienecho. Und die Schuwe hat sie auch wieder ausgezeichnet mit neunseitigem Schreiben, woraus sie aber nicht zitiert werden wollte. Das ist halt Schufa.
16:02
Das war jetzt noch Ministerin Baale forderte Schufa auf zu mehr Transparenz und das war im Detail Transparenz beim Scoring, staatliche Aufsicht und Aufklärungspflicht. Und was das dann bewirkt hat, war die Ankündigung zu dieser elektronischen Auskunft, die jetzt dann erfolgen sollte, dass jeder Benutzer dann, wenn er die Auskunft stellt, ab 2019 einen Brief nach Hause geschickt
16:22
bekommt mit einem Code, wo er online seinen Score abfragen kann, einmalig. Jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, dass man das einmalig machen kann, dann könnte man sagen, wenn das schon einmal funktioniert, könnte man einen Account dazugeben, dass man das regelmäßig machen kann und das er dann quasi wie beim Bezahlservice abfragen könnte und er die Möglichkeit hat, die Daten zu
16:42
korrigieren und das werden eigentlich unsere Forderungen, das werden wollen, dass Transparenz erst, wie wird der berechnet? Was sind die Merkmale, Gewichtungen und wie kann man seinen Datenbestand anschauen oder dass man Notification bekommt? Hey, Alter, du hast einen negativen Score reinbekommen wegen von Firma A, dass ihr A das weiß und B, falls das falsch sein sollte, ihr
17:01
reale Möglichkeit habt, diesen zu verbessern, weil das ist jetzt die Fälle, die wir wissen, dauert, dass Monate an intensiver Arbeit bis das mit den ganzen Firmen an den Strang kriegt, dass irgendwie in dieser Verarbeitungskette der Fehler da raus gebügelt wird. Das war jetzt einmal kurz, was wir hoffen, was in Zukunft kommt. Wir sagen immer, Schufa ist
17:20
der Anfang und nicht das Ende und wir werden dranbleiben und das Ganze läuft hoffentlich in diesem, was wir sagen, our data, my data, dass wir zeigen, was man machen kann, wenn man Daten schert, wenn man sich bewusst ist, was das bedeutet, wenn man uns seine privaten Finanzdaten gibt. Wir haben noch eine Slide zur Schufa.
17:42
Meine Lieblings-Slide hier raus. Die Frage ist natürlich, wie kann man die Schufa dazu kriegen, in Zukunft wieder mehr Daten rauszugeben? Die geben jetzt nicht alle Daten raus, die sie über einzelne Personen haben, sondern tatsächlich nur Daten, die sie anderen geben. Und wir gehen davon aus, dass eigentlich die Schufa viel mehr
18:00
rausgeben müsste nach der DSGVO. Und es gibt, glaube ich, zwei Wege, die Schufa dazu zu zwingen, mehr Infos wieder rauszugeben. Das eine ist eine Klage auf Basis von DSGVO. Das andere ist natürlich eine gesetzliche Verpflichtung. Deswegen ist auch wichtig, dass die Ministerin Bali das jetzt gefordert hat. Wir hoffen, dass da was
18:21
kommt. Und das wird jetzt ein richtig smoother Übergang. Das wird dann nämlich ein Gesetz, idealerweise. Und dieses Gesetz würde dann im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Ja, gut, ne? Und auch dafür haben wir was
18:41
parat. Stefan? Genau. Offene Gesetze. Am Anfang wurde ja schon gesagt, Gesetze, wo findet man die eigentlich? Wenn man nach dem Gesetz im Internet sucht, dann findet man die auf unterschiedlichen Seiten, zum Beispiel BUSA oder die JURE. Die offizielle Seite heißt GesetzeimInternet.de. Da ist das im Internet ganz wichtig, sonst weiß man ja gar
19:01
nicht genau, wo man gerade DUL eingibt. Und das ist eine Seite, wo da findet man alle Bundesgesetze und Verordnungen, und zwar in der aktuellen Version sozusagen. Einigermaßen aktuell. Das dauert manchmal ein paar Tage, bis da die aktuelle Version erscheint. Aber wie tritt eigentlich ein Gesetz in Kraft? Wie kommt es eigentlich dahin?
19:20
Und da habe ich das jetzt mal für das Publikum aufbereitet. Normalerweise, wenn man sucht Gesetzgebungsvorhaben, Gesetzgebungsprozess, dann findet man da irgendwelche Flowcharts. Ich habe das mal versucht, über einen Git Remote Prozess quasi darzustellen. Also es gibt dann quasi ein Branch von den Ministerien,
19:42
das ist der Referentenentwurf. Der geht dann an die Bundesregierung, die das im Bundeskabinett beschließt. Und das geht dann an den Bundestag. Dann gibt es zwischen Bundestag und Bundesrat vielleicht ein paar Commits. Diese Remotes tauschen ein paar Commits aus. Und dann geht das, wenn das dann beschlossen wurde, im Bundestag, dann unterschreibt das die Bundesregierung, ja,
20:01
also Gezeien sozusagen, getec-s. Und dann geht das an den Bundespräsidenten, der das auch nochmal unterzeichnet. Und dann wird das in den Production Release Branch der Bundesrepublik Deutschland gemerged und wird dadurch quasi Gesetz. Dadurch tritt das erst ins Kraft. Erst wenn es auf diesem Production Release Branch ist, ist es tatsächlich in
20:21
Kraft getreten. Vorher ist das noch nicht passiert. Bisschen ist jetzt aber die Frage, wo ist denn dieser Production Release Branch? Wo ist das Git-Log dafür? Und das Git-Log für diese Commits auf dem Branch, das ist das Bundesgesetzblatt. Das Bundesgesetzblatt, auch BGBL, nicht zu verwechseln mit dem bürgerlichen
20:41
Gesetzbuch, BGB, ist das Verkündungsblatt der Bundesrepublik Deutschland. Es heißt auch Verkündung und nicht Verkündigung. Verkündung, das ist das, religiöse Prophezeiungen und Gesetze. Die werden verkündet, alles anderes wird verkündigt. Und dort tritt es dann auch erst in Kraft, wenn es quasi
21:01
ausgedruckt und dort veröffentlicht wird. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass das erste Bundesgesetzblatt der BRD am 23. Mai 1949 dort wurde das Grundgesetz dann veröffentlicht. Und heutzutage sieht das leider immer noch genauso aus. Und zum Beispiel so.
21:20
Das ist jetzt ein Beispiel. Das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Das ist ein sogenanntes Artikel Gesetz und diese Gesetze, die im, diese Artikel Gesetze, die im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, die verändern bestehende Gesetze. Das heißt, es ist sozusagen ein Patch. Wenn man sich das hier anguckt, dann steht da das bürgerliche
21:41
Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung von so und so und nun ist wie folgt geändert, dem Paragraphen 1309 und da unten steht dem Paragraph 1353 Absatz 1, wird wie folgt gefasst. Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Also ich als als Nerd
22:00
denke immer, das ist furchtbar kompliziert zu lesen. Ich weiß ja gar nicht, was der Kontext ist. Und ich kenne das ja eher so. Und das macht auch für mich viel mehr Sinn, weil dann dann sehe ich halt, was wurde hinzugefügt, was ist weggekommen.
22:21
Aber die Problematik, dass es das quasi menschenlesbar und nicht maschinenlesbar ist, ist leider noch eine andere offene Gesetze, hat sich eher mit den rechtlichen Problematik befasst, denn das Bundesgesetzblatt, wenn man das im Internet sucht, dann findet man die Seite bgbl.de und die sieht folgendermaßen aus, hatte noch so einen schönen 2006
22:40
glossy Reflektion, finde ich sehr gut. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sehe ich als erstes das hier, Bundesanzeiger Verlag. Das ist also, ist das, wem gehört er denn, was ist das denn? Der Bundesanzeiger Verlag ist mittlerweile ein privater Verlag, das hat dem Bund gehört, wurde 1998 aber teil privatisiert.
23:00
2006 wurde er dann vollständig privatisiert und er gehört zur DuMont Mediengruppe. Die DuMont Mediengruppe, Sie kennen das vielleicht von der Berliner Zeitung, der Berliner Kurier, dem Express in Köln oder der Hamburger Mopo. Also alles Qualitätsblätter und diese DuMont Mediengruppe, die bringt auch unsere Gesetze heraus.
23:21
Wenn man ein bisschen auf der Webseite weiterklickt, dann findet man den kostenlosen Bürgerzugang, kostenlos finde ich immer super, klicke ich sofort drauf und dann grüßt mich erst mal so ein großes grünes, ein großer grüne Box und da drin steht die elektronische Version des Bundesgesetzplatzes genießt generell Datenbankschutz nach § 87a vor folgende Urheberrechtsgesetz.
23:41
Das heißt, der Bundesanzeiger Verlag beansprucht Datenbankschutzrecht auf die Sammlung der Bundesgesetzblätter, die er veröffentlicht. Jedes einzelne Gesetzblatt ist nach, ist ein amtliches Werk nach § 5 Urheberrechtsgesetz und genießt keinen urheberrechtlichen Schutz. Aber die Sammlung dieser
24:01
Gesetzblätter könnte man sagen, dass es ein Leistungsschutzrecht, ein Datenbankleistungsschutzrecht ist, der Datenbankschutz und der wird auf jeden Fall hier sehr explizit und auch ganz oben auf der Seite direkt unübersehbar vom Bundesanzeiger Verlag beansprucht. Wenn man dann so ein bisschen weiter versucht, sich durch die Gesetzesblätter dazu klicken, merkt man, es gibt keine Suche.
24:21
Man merkt, es gibt kein OCR von PDFs vor 1998. Da sind das dann alles einfach nur Bilder. Die PDFs sind gegen Copy und Pasten und Ausdrucken geschützt. Weil wir wissen, wie man das vielleicht wegbekommt. Aber der normale Nutzer, der vielleicht einfach schnell irgendwas rauscopieren pasten will, da sagt dann der ein oder andere PDF-Reader,
24:40
das geht jetzt nicht, weil da irgendwie mal ein Passwort eingeben muss, ist natürlich eigentlich Quatsch. Und die Gesetzesseiten selbst enthalten auch Werbung im Futter. Also nicht für McDonald's oder so, sondern eher, da steht dann hier auf bgbl.de. Könnt ihr das alles hier angucken? Und da ist noch ein Logo vom Bundesanzeigerverlag, also einem privaten Unternehmen. Ich finde es ein bisschen
25:00
unwürdig für unsere Gesetze, wenn da im Futter dann sozusagen noch extra was drauf getan wird, was halt nichts mit dem Gesetzgebungsprozess selbst zu tun hat. Aber, aber man bekommt das natürlich auch anders. Man kann tatsächlich beim
25:21
Bundesanzeigerverlag ein Onlinearchiv im Halbjahres Abonnement abschließen. Das kostet dann schlappe 99 Euro pro halbes Jahr. Dann bekommt man auch eine Suche, die Dokumente sind auf einmal ausdruckbar. Es lassen sich Textstellen entnehmen, wie Sie so schön sagen, also der Copy und Paste. Und das Ganze gibt es auch als E-Mail, Newsletter. Wenn ein Bundesgesetzwart
25:40
rauskommt, dann kostet dann auch das Halbjahresabonnement, damit man dieses Gesetzbart per E-Mail bekommt, 108 Euro. Etwas seltsam, wir wollten es genauer wissen. Wie hat denn der Bundesanzeigerverlag dort, wie ist er denn da rangekommen an diese Privatisierung? Und wir haben versucht, diesen Vertrag anzufragen. Das ist der Vertrag mit dem Bundesanzeigerverlag. Die Anfrage findet auf
26:01
fragt den Staat. Und da ist ganz interessant. Ihr seht, es ist viel geschwärzt, also quasi fast die Hälfte, würde ich sagen. Wir haben da Widerspruch eingelegt. Das ist jetzt noch. Das läuft noch. Aber die Begründung für diese Schwärzung, die Schwärzungsstellen, da geht es um die Laufzeit des Verlages, das Inkrafttreten des Vertrages, das Inkrafttreten
26:21
des Vertrages wurde geschwärzt und wie die urheberrechtliche Position dieser Gesetzblätter ist. Das heißt, das konnten wir gar nicht herausfinden. Das wurde vom Bundesjustizministerium geschwärzt und da heißt es dann die Geheimhaltungsinteressen wegen der unmittelbaren Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation des Bundesanzeigerverlages. Deswegen musste das dann
26:41
geschwärzt werden. Unsere Reaktion war diese Bundesgesetzblätter alle auf offene Gesetze zu veröffentlichen. Hurra. Das haben wir zusammen mit Johannes Filter, Arne und ich gemacht.
27:02
Das ist ganz eine Seite, da könnt ihr die Bundesgesetzblätter durchsuchen. Ihr könnt sie auch herunterladen. Es gibt Textversionen. Und damit das Justizministerium das auch findet, haben wir auch das noch im Internet veröffentlicht, also unter offene Gesetze im Internet.
27:27
Hier der Start-up-Page- Feature-Vergleich. Der kostenlose Bürgerzugang hat überall Nein, wir haben überall Ja, die Dokumente sind druckbar, Volltext-Suche, Texte in älteren Ausgaben. Ein Gesamtdauner, wir stellen sozusagen Tar Balls
27:41
für die Gesetzblätter, über Jahre, aber auch für zum Beispiel das gesamte BGBL 1 und auch die BGBL 2 Version zur Verfügung. Das sind dann 6 Gigabyte PDFs, wenn ihr die runterladen wollt und damit irgendwas Schönes machen wollt, tut das gerne. Wenn denn wir sagen, freie Verweiterverwendung, alles in Ordnung. Wir haben auch stabile Links. BGBL hat leider keine stabilen Links auf seine PDFs.
28:01
Ja, das sind alles Session-Links. Die kann man noch nicht mehr direkt darauf verweisen. Wir haben RSS-Feeds, eine kleine API und natürlich alle Funktionen kostenlos. Die Reaktion... Die Reaktion wurde sehr gut aufgenommen, habe ich auch gerade hier gehört. Danke.
28:21
Und auch die Jurakommunity hat das sehr gut aufgenommen. Rechtsprofessoren haben darüber Blogpost geschrieben, haben sich sehr gefreut, dass sich da jetzt so etwas ergeben hat. Offenbar gab es da sehr lange Stillstand in der Rechtscommunity und sie haben sich, haben das sehr wohlwollend aufgenommen. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat auch Frau Barley, da ist sie schon wieder,
28:41
gesagt, dass sie also die FAZ titelt, Barley nimmt Dumont-Vorlag das Gesetzblatt weg. Das klingt jetzt sehr hart, aber es ist schon länger eine E- Verkündung, also eine elektronische Verkündung des Bundesgesetzblattes geplant. Das ist allerdings erst ab 2021 der Fall. Das bedeutet, dass dann das
29:00
Gesetz nicht mehr ausgedruckt werden muss, damit es in Kraft tritt, sondern dann muss es nur noch online veröffentlicht werden. Aber was neu war in der Artikel, dass auch die bestehenden Bundesgesetzblätter durchsuchbar und online dann zur Verfügung gestellt werden vom Gesetz, also von der Regierung selbst, vom Staat. Und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt.
29:20
Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, diese Entscheidung da zu forcieren. Ganz interessant ist auch, dass die Juris GmbH, die erste war, die diesen Tweet von dem FAZ- Reporter retweetet hat, die Juris GmbH, die macht ungefähr das Gleiche nur mit Urteilen und die müsste man sich auch mal genauer angucken.
29:47
Also wie geht es weiter? Wir warten auf eine Klage bzw. wir sind gar nicht sicher, weil eigentlich finden wir nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Aber wir gucken mal, wie das beim Bundesanzeiger Verlag aufgenommen wird. Wir waren jetzt vier Tage nicht zu Hause, deswegen vielleicht liegt da schon was im Briefkasten.
30:01
Wir werden das BGBL noch ein bisschen weiter aufräumen. Wir haben festgestellt, dass auf der BGBL-Seite selbst da sind Metadaten auch nicht vollständig oft falsch. Datumsangaben sind korrupt. Das heißt, das Datum funktioniert gar nicht, kann man gar nicht parsen. Und natürlich gibt es noch sehr viele andere Gesetze und Amtsblätter. Also es gibt noch zum Beispiel das gemeinsame Ministerialblatt,
30:21
das auch noch sehr wichtig ist für die Bundesverordnungen. Aber es gibt noch viele andere auf vielen verschiedenen Ebenen, auf Länderebene und auch auf Gemeindeebene. Dort gibt es auch Amtsblätter und die sind wahrscheinlich alle viele in den Händen von privaten Verlagen. Oft sind sie öffentlich verfügbar in irgendeiner Form.
30:40
Oft muss man aber auch dafür zahlen. Und da sollten wir gemeinsam weiter daran arbeiten, dass sowas verfügbar wird. Da könnt ihr auch gerne selber aktiv werden. Ansonsten war das jetzt Open Schufa und offene Gesetze bei der Projekte der Open Knowledge Foundation Deutschland. Die Klammer ist so ein bisschen, dass wir versuchen, die Regeln, die
31:01
sehr alteingesessene Unternehmen uns versuchen, aufzuoktroyieren, da ein bisschen aufzubrechen. Die Schufa und auch der Bundesanzeigeverlag sind sehr alte traditionelle Unternehmen. Das wurde schon immer ausgedruckt, das wurde schon immer so erfasst. Aber ich glaube, wir haben einen neuen Anspruch an Transparenz und
31:21
auch an Durchsuchbarkeit für Weiterverwendbarkeit. Und das versuchen wir bei der Open Knowledge Foundation ein bisschen voranzubringen. Vielen Dank.
31:52
In anderen Räumen waren die immer schon an. Dankeschön für den Talk. Sehr interessant. Ich bin mal kurz dazugestoßen.
32:01
Wir haben noch 10 Minuten für Q&A. Bitte an den Mikrofon anstellen. Mikrofon Nummer zwei, bitte. Es gab Anfang Mitte des Jahres ging um, dass durch die DSGVO das gesamte Geschäftsmodell der Schufa betroffen sein könnte, um es mal so auszudrücken.
32:21
Ich habe jetzt nicht verfolgt, wie es sich weiterentwickelt hat. Ist da noch was draus geworden? Hat mittlerweile ein Datenschutzbeauftragter gesagt, nee, ist alles okay oder? Es gibt die Schufa noch. Also zuständig für die Schufa ist der hessische Datenschutzbeauftragte, der geht
32:41
nicht in einer Konsequenz gegen die Schufa vor, wie er es machen müsste aus unserer Sicht. Ich glaube, wäre die die Schufa in einem anderen Bundesland angesiedelt, dann sähe es jetzt ein bisschen anders aus. Tatsächlich die eine Veränderung, die es gab durch den Datenschutzbeauftragten, ist eben diese elektronische Auskunft. Also die Schufa hat
33:00
vorher nur Post zugesandt, hat jetzt zugesichert an den Datenschutzbeauftragten, dass sie es ab Januar dann aber auch wirklich per E-Mail machen beziehungsweise per Post, ein Zugangscode. Ah ja, gar nicht, ist gar nicht per E-Mail. Ein Zugangscode per Post und dann bei denen online. Das ist so die eine Veränderung. Und tatsächlich, was so alles weitere angeht,
33:20
haben wir bisher nicht gehört, dass der Datenschutzbeauftragte in Hessen ein Problem damit hätte. Im Gegenteil, wir haben eher gehört, dass der ein Problem mit Open Schufa hatte. Da muss man ja sagen, das Geschäftsmodell, der Haupt Einnahmequelle der Schufa ist ja nicht, dass die persönliche Einzelpersonen da nötig, dass sie den Onlinezugang haben, sondern die machen ja Datenverkauf von
33:41
Firmen. Danke. Mikrofon Nummer zwei nochmal. Ich wollte mal fragen, wie das Status ist. Sammelt ihr für Open Schufa noch Daten? Aufgrund dieser wirklich sehr, sehr verkürzten Auskünfte, die es zurzeit gibt, bringt uns das nicht so viel. Also die Auskünfte, die halt einige Menschen derzeit
34:01
bekommen, besteht tatsächlich dann teilweise nur aus einer Zeile oder noch nicht mal. Und das sind dann keine Daten, die man sinnvoll in der Zeit einfügen kann. Deswegen pausiert es gerade. Wir hoffen aber, dass, wenn wir ordentlich Druck aufgeübt haben auf die Schufa und da wieder ordentliche, längere Auskünfte kommen, wir damit dann wiederum was anfangen können.
34:21
Wir hoffen, es wird überflüssig, weil das Justizminister am Eingreifen wird. Mikrofon Nummer eins, bitte. Hallo, ich habe auch eine Frage an die Macher vom Open Schufa Projekt. Und zwar habt ihr ja nun da eine Menge. Sehr wichtiger, persönlicher Daten bekommen. Und dann ist ja auch
34:41
die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten. Und ich würde gerne mal in einem Block in eure eigenen Erfahrungen haben, wie ihr damit umgegangen seid, selber Datenschutz-Compliment zu sein. Also wir hatten da rechtliche Unterstützung. Die Daten gingen auch nur dann zwei Medienunternehmen
35:02
raus, extern, die damit gearbeitet haben, sonst was inhouse von Open Knowledge Foundation oder Algorithm Watch, unseren Partner. Genau, das ist der Datenschutzbeauftragte Nico Herting, der hat das übernommen. Man muss noch mal zu den Daten dazu sagen, wir waren nicht interessiert an den Namen oder so. Die waren in der Regel nicht dabei, es sei denn, Leute haben beim Upload einen Fehler
35:20
gemacht und aus Versehen ihre Daten, also ihren Namen und und so sehr einfach identifizierbare Daten mitgeschickt. Das heißt, idealerweise haben wir diese Daten überhaupt nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wenn man so ein Schufas Blatt hat, dass das komplett anonym ist. Also es ist natürlich eine bestimmte Detailletiefe, dass man
35:41
mit bestimmten Verfahren sicherlich das rückschließen kann auf einzelne Leute. Wir veröffentlichen diese Daten zum Beispiel auch nicht. Das ist sicherlich also ein das wurde häufig an uns rangetragen, auch von anderen Forschern, dass sie gerne mit diesem Datensatz arbeiten würden. Das machen wir derzeit aber so nicht. Das geht einfach nicht
36:01
mit diesem Datensatz. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet, der Signalange bitte. Habt ihr vor die Gesetzesblätter als Code Patch Version zu veröffentlichen beziehungsweise arbeitet ihr an einem maschinen lesbaren Datenformat für
36:20
Gesetzesänderungen? Also momentan haben wir uns nur auf die rechtliche Problematik des Ganzen gestützt. Es gab mal ein Projekt namens Bundesgit, was tatsächlich versucht hat, die Bundesgesetze auf GitHub zu versionieren. Diese Nachversionierung. Ich habe das selber gemacht. Und das war sehr viel Handarbeit, sozusagen zu reverse
36:41
engineern, wie diese zustande kommen. Wir haben aber hier so einen Legal Hack Day gehabt, so einen Hack-Workshop in so einer Assembly. Und wir haben halt geguckt, ist es möglich, diese diese Patche aus den Bundesgesetzblättern zu extrahieren, ja, mit irgendwie neueren Natural Language
37:00
Processing Sachen, die PDFs auseinandernehmen und dann zu gucken, kann man jetzt irgendwie herausfinden, welcher Paragraph da wie angepasst wurde. Leider gibt es halt sehr viele Varianten, wie das da stehen kann. Wenn man das von Hand macht, dann dauert das sehr lange und es ist sehr viel Aufwand. Es gibt da Seiten, die machen das, im Schibuse. Und wir würden das jetzt das Bundesgit, vielleicht gibt es
37:21
da nochmal einen Neustart. Aber das ist, das ist kompliziert. Es ist eine sehr komplizierte Materie, sehr viel Arbeit. Und eigentlich hätte ich ja gerne, dass das nicht sozusagen von reverse engineert wird, wie Open Schufa, sondern dass das auch von Gesetzgeber selber so passiert, dass man da herausfinden kann, was
37:41
hat sich denn wirklich geändert? Das würde wahrscheinlich auch den Gesetzgebungsprozess vereinfachen. Die Leute tippen das immer noch alles in Wörterteilen ein und sagen, okay, wir würden das jetzt gerne so ändern. Anstatt das Gesetz selbst zu ändern und sozusagen zu versionieren, wird dann diese Änderungsgesetze gemacht. Und das ist kompliziert. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. Ich habe mit ein paar Juristen gesprochen, die sehen das jetzt in
38:02
absehbarer Zeit nicht. Also auch diese E-Verkündung wird eher so weiter laufen, wie wir in den aktuellen menschenlesbaren Patchen gesehen haben. Also gibt, glaube ich, nicht so viel Fortschritt, es sei denn, wir machen das wirklich selbst. Das ist aber viel Aufwand. Man muss aber schon dazu sagen, wir sind natürlich die Einzigen, die diese Art hassen.
38:20
Auch die Verwaltung hasst es. Also und auch und auch Bundestagsabgeordnete hassen das. Also es gibt eigentlich so gut wie niemanden, der diese althergebrachte Form eigentlich wirklich gut findet. Es gibt ein Projekt im Justizministerium, das heißt E-Gesetzgebung. Alles E. Und die arbeiten ein bisschen daran. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da darum, vor allem Plugin für Word
38:41
zu schaffen. Super. Mikrofon Nummer zwei. Noch mal bitte. Mich interessiert, wo die Daten, wo die Gesetze herkommen, die auf offene Gesetze dann jetzt gelandet sind. Hat die jemand von Hand aus diesem Bürgerzugang gekratzt
39:01
und dann zusätzlich noch OCR, die die nicht schon OCR waren. Und wenn das so ist, habt ihr die Werbung raus entfernt? Also ist ja keine Werbung mehr drin. Aber wo das jetzt genau herkommt, das können wir leider jetzt nicht sagen.
39:25
Und wir haben noch Zeit für eine Frage. Mikrofon eins, bitte. Hi, guter Vortrag. Ich war gerade in den Lightning Talks und habe gehört von einem Projekt, das versucht, Gerichtsentscheide zu veröffentlichen. Habt ihr das auch schon mitbekommen oder arbeitet ihr mit denen zusammen?
39:41
Open Legal Data. Ja, es gibt da glücklicherweise in diesem Bereich einige wirklich coole Leute, die die versuchen, nicht eben nur Gesetze, sondern auch Urteile an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir sind da schon in Gesprächen, wie man sich da so verklagen lassen könnte.
40:00
Super. Herzlichen Dank nochmal. Riesen Applaus nochmal für die Speaker.