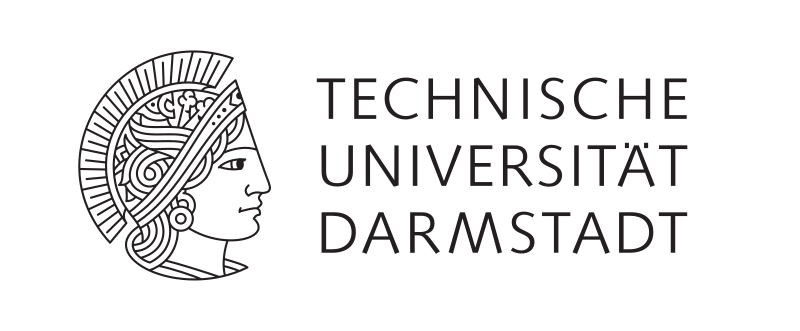2. Vorlesung: Topologische Grundbegriffe
Formal Metadata
| Title |
| |
| Title of Series | ||
| Part Number | 2 | |
| Number of Parts | 26 | |
| Author | ||
| License | CC Attribution - ShareAlike 4.0 International: You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this | |
| Identifiers | 10.5446/17113 (DOI) | |
| Publisher | ||
| Release Date | ||
| Language |
Content Metadata
| Subject Area | |
| Genre |
Analysis II SS 20162 / 26
1
6
9
12
13
14
15
16
17
19
21
22
24
25
26
00:00
Mathematical analysisSequenceSet (mathematics)Symmetry (physics)LinieNormed vector spaceAxiomVector spaceInequality (mathematics)Line (geometry)MereologyMetrischer RaumMetric systemMoment (mathematics)Term (mathematics)Goodness of fitCounterexampleLengthBasis <Mathematik>DistanceExterior algebraPoint (geometry)ExpressionDifferent (Kate Ryan album)Multiplication signDreiecksungleichungSpacetimeRight angleMathematical analysisMathematicsComputer animation
09:14
Mathematical analysisCurveMathematicsNetwork topologyEuclidean vectorRoutingWave packetInvariant (mathematics)Category of beingVector spaceUniqueness quantificationLine (geometry)Limit of a functionMaxima and minimaMetrischer RaumMetric systemTerm (mathematics)AreaVector graphicsMeasurementCounterexampleLengthDistanceNormal (geometry)Translation (relic)Point (geometry)Open setCircleDirection (geometry)Student's t-testRadiusMetreTrailSelectivity (electronic)Different (Kate Ryan album)Block (periodic table)Boundary value problemMathematical analysisAiry functionComputer animation
18:28
Algebraic structureSequenceLogicSet (mathematics)Arithmetic meanProof theorySheaf (mathematics)Bounded setLimit of a functionLimit (category theory)MereologyMetrischer RaumMetric systemSubsetTerm (mathematics)Thermodynamisches SystemAreaGoodness of fitDistanceMassDerived set (mathematics)Normal (geometry)Presentation of a groupNeighbourhood (graph theory)Point (geometry)Absolute valueMathematicsLimit of a sequenceOpen setCircleDirection (geometry)RadiusClosed setCondition numberMultiplication signSpacetimeMathematical analysisMathematicsComputer animation
28:58
Set (mathematics)Set theoryZusammenhang <Mathematik>Arithmetic meanPropositional formulaProof theoryMereologyMetrischer RaumMoment (mathematics)Standard errorAreaNichtlineares GleichungssystemDistancePoint (geometry)Mischung <Mathematik>Open setCircleObservational studyInclusion mapRadiusSign (mathematics)Closed setAbgeschlossenheit <Mathematik>Different (Kate Ryan album)Multiplication signRight angleMathematical analysisMathematicsComputer animation
38:53
Set (mathematics)PolynomialNetwork topologyMatrix (mathematics)Category of beingAverageInfinityUniverse (mathematics)Limit (category theory)MereologyMetrischer RaumMoment (mathematics)SubsetTerm (mathematics)Real numberBasis <Mathematik>DistancePoint (geometry)Negative numberOpen setInclusion mapRadiusFilm editingPartial derivativeSign (mathematics)Closed setAbgeschlossenheit <Mathematik>Different (Kate Ryan album)Multiplication signMathematical analysisMathematicsComputer animation
48:49
Algebraic structureSequenceMaß <Mathematik>Set (mathematics)Numerical analysisRational numberDescriptive statisticsPositional notationRaum <Mathematik>ModulformCombinatory logicCategory of beingAlgebraic closureZusammenhang <Mathematik>InfinityAbgeschlossene TeilmengeArithmetic meanProof theoryConnected spaceGenerating functionLimit of a functionHüllenbildungIndexPrice indexIndexmengeChainComplementarityComplex (psychology)Maxima and minimaMereologyMetrischer RaumMoment (mathematics)Negative numberResultantSubsetTerm (mathematics)Thermodynamisches SystemNumberGoodness of fitNichtlineares GleichungssystemReal numberLengthSubgroupDistanceParameter (computer programming)MassCross section (physics)Complete metric spaceSquare numberGastropod shellPoint (geometry)Negative numberOpen setInterior (topology)CircleObservational studyInclusion mapDirection (geometry)Equaliser (mathematics)RadiusExpressionFilm editingGreatest elementSign (mathematics)Closed setAbgeschlossenheit <Mathematik>Different (Kate Ryan album)Element (mathematics)Multiplication signRule of inference2 (number)Right angleEnde <Graphentheorie>Position operator1 (number)Mathematical analysisMathematicsComputer animation
Transcript: German(auto-generated)
00:05
So, dann mal herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung, Analyse 2. Bevor ich loslege, nochmal, ich glaube, ich habe es auch gestern schon gesagt, aber dann kam noch wieder jemand
00:22
zu mir zum Thema meiner Sprechstunde. Ich weiß, dass im selben Fall noch jemand Vorlesungen drauf hat. Ich lege die halt irgendwo hin. Nochmal, wer was will, melde sich einfach auf irgendeinem Wege. Wir finden einen Termin. Also, die Sprechstunde ist nicht heilig, sondern nur ein Zeitpunkt, zu dem ich garantiere, da zu sein. Das gilt insbesondere auch für die
00:43
Leute, die Interesse haben, an dem Knobelpro Seminar teilzunehmen. Wer nicht am nächsten Dienstag kann, kann natürlich trotzdem mitmachen. Überhaupt kein Problem. Melden Sie sich und dann organisieren wir das. So, mathematisch haben wir uns letzte Stunde im Wesentlichen damit
01:04
beschäftigt, uns einen möglichst allgemeinen Begriff eines Abstandes zu bauen. Weil ein Abstand, das werden wir jetzt hoffentlich noch heute sehen, die Grundlage all dessen ist, dass man Analysis betreiben kann, weil man über einen Abstand sofort aussagen kann, was eine Konvergenz ist und dann baut man da drauf auf. Der Abstand ist gegeben durch das,
01:29
was ich eine Metrik genannt habe. Wir kennen jetzt schon einen Stapel Metriken, weil wir haben gesehen, jede Norm erzeugt eine Metrik. Der Abstand von zwei Punkten ist die Norm ihrer
01:40
Differenz. Ich habe aber gesagt, der Begriff der Metrik ist bewusst allgemeiner. Jetzt würden wir auch gerne noch ein paar Metriken sehen, die nicht nur von Normen kommen und das will ich jetzt im nächsten Beispiel tun, um Ihnen zu zeigen, dass dieser Begriff wirklich mehr kann als eine Norm. Der erste Punkt war gesagt, eine Norm kriegen Sie nur, wenn Sie einen
02:04
Vektoraum haben, weil eine Norm, sehen Sie schon in der Definition der Axiome, da taucht Lambda mal X und da taucht X plus Y auf. Wenn man keinen Vektoraum hat, sondern irgendeine Menge, dann ist X plus Y da drauf nicht wirklich gut definiert. Deswegen jetzt als
02:21
erstes ein Beispiel einer Metrik, die immer geht. Für eine beliebige nicht leere Menge kann man immer eine Metrik definieren. Die sogenannte diskrete Metrik, die will ich Ihnen jetzt vorführen. Also M ist irgendeine Menge, nur nicht leer. Und dann kann ich da
02:41
folgendermaßen eine Metrik definieren. Der Abstand von zwei Punkten, der ist entweder Null, wenn X gleich Y ist. Das muss so sein. Das ist die erste Axiom der Metrik. Der Abstand von einem Punkt mit sich selber muss Null sein. Und ansonsten, wenn X
03:01
nicht Null, Y ist, setzen wir die Metrik immer eins. Das ist schon ein bisschen die extreme Metrik. Entweder zwei Punkte sind gleich oder sie sind nicht gleich. Wenn sie gleich sind, ist der Abstand Null und alle anderen am Abstand eins. Das nennt sich die diskrete Metrik. Den Namen kann man auf verschiedene Weisen auffassen. Sie hat
03:27
nur zwei diskrete Werte. Wo der eigentlich herkommt, werden wir so in den nächsten Wochen uns erarbeiten. Aber wichtig ist eben, es ist eine Metrik, die auf jedem Raum funktioniert oder auf jeder Menge. Damit können Sie jede Menge, wenn Sie wollen,
03:41
zu einem metrischen Raum machen. Wir werden feststellen, es ist von seinen Eigenschaften her ein sehr extremer metrischer Raum. Nicht für alles geeignet. Es gibt auf dem zum Beispiel nicht wahnsinnig viele konvergente Folgen. Das werden wir auch noch sehen. Aber es ist erst mal eine Metrik. Gut, warum muss man sich die Metrikaxiome überlegen? Dabei
04:05
können wir die gerade noch mal ins Gedächtnis rufen. Was war das erste Metrikaxiom? Das erste Metrikaxiom war, dass der Abstand von zwei Punkten Null ist, dann und nur dann, wenn die beiden Punkte gleich sind. Das ist hier offensichtlich der
04:23
Fall. Mein Sohn ist genau definiert. Der Abstand ist immer Null, wenn die beiden gleich sind und sonst ist er eins. Das zweite Metrikaxiom war die Symmetrie. Der Hinweg von X nach Y ist genauso lang wie der Rückweg von Y nach X. Auch das ist hier erfüllt. Wenn
04:42
X gleich Y ist, sind sie beide Null und wenn X nicht gleich Y ist, sind sie beide eins. Also M1, M2 haben wir. Bleibt M3. Das ist auch nicht tiefsinnig. Da muss man ein bisschen mehr überlegen. Ich schreibe erst mal hin, was war M3? M3 war die Dreiecksungleichung. Der
05:07
ist kleiner, kürzer als wenn man den Umweg läuft. Also der Abstand von X zu Y ist kleiner als der Abstand von X zu Z plus der Abstand von Z zu Y. Und das jeweils für alle X, Y, Z. Warum
05:23
gilt das hier? Naja, nehmen Sie sich drei Punkte X, Y und Z her und dann kann man zwei Fälle unterscheiden. Wenn X gleich Y ist, dann ist der Abstand von X zu Y Null. Naja, wurscht,
05:45
was auf der rechten Seite steht. Der Ausdruck da oben ist immer positiv. Die Ungleichung stimmt auf jeden Fall. Null ist auf jeden Fall kleiner gleich D von X Z plus D von Z Y. Okay,
06:02
was ist wenn X nicht Y ist? Wenn X nicht Y ist, dann könnte Z zwei X sein oder Y, aber es kann nicht gleich X und gleich Y sein. Also dann haben wir entweder X ungleich Z oder Y ungleich Z. Es ist für das Z schwierig, gleich zwei verschiedene Punkte zu sein. Okay,
06:26
und das heißt, links steht zwar 1, aber rechts steht auch mindestens 1. Und da oben steht rechts 2, aber auf jeden Fall mal mindestens 1. Also der Abstand von X zu Z plus der Abstand von Z zu Y, der ist mindestens 1. Einer von den beiden ist 1 und der Abstand und 1 ist
06:47
genau der Abstand von X zu Y. Okay, also wir haben es tatsächlich mit der Metrik zu tun. Wir werden sehen, dass eine relativ extreme Metrik kann man, aber ist eben eine Metrik,
07:01
die den Vorteil hat, dass sie auf jeder Menge funktioniert. Außerdem kann man auch noch als Hinweis geben, wenn Sie Gegenbeispiele suchen zu irgendeiner Aussage, probieren Sie es erst mit der diskreten Metrik, weil die eben so eine extreme Metrik ist,
07:24
ist die oft ein gutes Gegenbeispiel für irgendwas. So, die zweite Metrik, die ich Ihnen zeigen will, ist auch eine Metrik, die nicht von einer Norm kommt. Sie wird mit Hilfe einer Norm definiert, aber sie kommt nicht in dem Sinne von einer Norm, wie wir es hatten,
07:42
dass der Abstand einfach die Norm von der Differenz ist. Und zwar sieht die folgendermaßen aus, ich schreibe sie erst mal hin. Also wir brauchen eine Norm, wir brauchen einen normierten Raum. Nehmen wir einen normierten Vektoraum her und dann definiere ich den
08:01
Abstand von zwei Punkten in diesem Raum als entweder den üblichen bekannten Abstand von x zu y, wenn die beiden Linien abhängig sind und wenn die beiden Linien unabhängig sind, also schreibe ich sie sonst. Dann nehme ich die Länge von x plus die Länge von y. Ich behaupte,
08:32
das ist eine Metrik auf v. Wie sieht die aus? Also dass das eine Metrik ist,
08:41
das überlasse ich Ihnen im Moment, das finden Sie auf dem nächsten Übungsblatt. Wie sieht die aus oder was macht die? Ich male sie mal im R2 hin, das ist ein Vektoraum, den man ganz gut malen kann. Wenn Sie hier einen Punkt x haben und jetzt einen Punkt y auf
09:04
der gleichen Gerade, also davon Linie abhängig, dann ist der Abstand von den beiden einfach ganz gewöhnlich der Abstand. Wenn ich meinen Punkt y woanders hinlege, also zum Beispiel hier, was ist dann der Abstand von x zu y? Dann ist der Abstand von x zu y die Länge
09:21
von x plus die Länge von y. Also was diese Metrik misst, ist den Abstand entweder, den Sie auf direktem Wege machen können oder wenn die beiden Linien unabhängig sind, den Abstand, den Sie haben, wenn Sie über den Ursprung dahin laufen. Und irgendwelche
09:41
Spaßvögel haben in Überzeichnung der Realitäten das Ding französische Eisenbahnmetrik genannt oder auch SNCF-Metrik. Wer mal in Frankreich Bahn gefahren ist, weiß warum. Egal von wo nach wo man will, man muss immer über Paris. Also hier ist Paris. Es gibt so ein
10:04
paar Peripherlinien, aber das ist eben die Extremversion davon. Also in dem Lebensfremde, das ist eben der Abstand zwischen zwei Punkten. Wenn ich ein extrem
10:21
zentralisiertes System habe, das heißt ich kann von einem Punkt zu einem anderen nur über den Ursprung laufen. Es sei denn die beiden liegen zufällig an der gleichen Bahnlinie, dann kann ich natürlich direkt fahren. Das ist die sogenannte französische Eisenbahnmetrik oder SNCF-Metrik und das Entscheidende an der oder weshalb man die üblicherweise bringt
10:43
als Beispiel ist nicht, weil sie so wahnsinnig oft vorkommt, sondern erstens, weil sie auch häufig ein schönes Gegenbeispiel ist und zweitens, weil diese Metrik ein schönes Beispiel dafür ist, dass man auch auf einem Vektoraum eine bauen kann, die nicht mit einer
11:04
Norm assoziiert ist. Also die Behauptung ist, es gibt keine Norm in dem Vektoraum, also hier im R2, sodass diese Metrik rauskommt durch diese Norm. Woran liegt das? Das liegt
11:23
daran, also ich behaupte, es gibt keine Norm, irgendeine andere Norm, noch eine mit 3 Strichen auf V, sodass diese französische Eisenbahnmetrik gegeben ist durch diese Norm,
11:45
sodass sie den Abstand immer sehen können als die Länge der Differenz von den beiden Vektoren für alle x, y und v. Egal wie sie ihre Norm bauen, das geht nicht und der Grund ist, dass wenn das so wäre, dann wäre die Metrik sogenannt Translationsinvariant,
12:14
dann würde für alle x, y und z aus dem Raum gelten, dass D von x plus z, y plus z, also sie
12:25
nehmen die zwei Punkte, verschieben beide um den gleichen Vektor und schauen sich dann den Abstand. So wenn es jetzt so eine Norm gäbe, dann wäre dieser Abstand die Norm von der Differenz, also x minus z minus y plus z, dann fällt das z raus, es käme also raus die Norm von
12:49
der Differenz von x und y, das heißt es käme raus der Abstand von x und y. Sowas nennt man eine Metrik ist Translationsinvariant, wenn sie beide Punkte um den selben Vektor schieben,
13:02
ändert sich der Abstand nicht, das ist bei einer Norm klar, der Abstand ist die Länge vom Verbindungsvektor, wenn sie den Vektor um irgendwas schieben, dann ändert sich der nicht und ändert sich auch die Länge nicht. Das heißt, wann immer sie eine Metrik haben, die von einer Norm kommt, hat die automatisch diese Eigenschaft. Die französische Eisenbahnmetrik
13:20
hat die offensichtlich nicht. Wenn sie sich diese beiden Punkte x und y, die ich hier mit schwarz genommen habe, also dies x und dieses y, schieben sie die beide zwei Meter rauf, eben genau nicht die Linie, sowas ist jetzt der Abstand von hier nach hier, die liegen jetzt nicht mehr an einer Strecke, die nach Paris führt, also ist der Abstand
13:44
jetzt das. Daran sieht man, diese Metrik ist keine Metrik, die von einer Norm kommt und dementsprechend ein interessantes Beispiel für eine Metrik auf einem Vektoraum,
14:01
die nicht durch eine Norm gegeben ist. Ich hatte in der letzten Vorlesung gesagt, wenn man so eine Norm oder so eine Metrik in die Finger kriegt und man irgendein Gebilde hat, in dem man malen kann, dass man sich grafisch darstellen kann, dann ist immer gut, malen Sie sich mal eine Kugel hin. Malen Sie sich mal eine Kugel mit Radius 1 hin,
14:21
dann sieht man so ein bisschen, was das Ding macht. Sollten wir hier also auch noch tun. Wie sieht so eine Kugel in der französischen Eisenbahnmetrik aus? Die Kugel um null mit
14:42
Radius 1 ist ziemlich langweilig. Wie sieht die Kugel um null mit Radius 1 aus? Na ja, wo kommen sie überall hin, wenn sie von Paris aus starten und ein Kilometer weit fahren? Na ja, dann kommen sie überall dahin, wo man von Paris halt mit einem hinkommt. Das sieht genauso aus wie bei der Euklidnorm. Also ich mache jetzt die Eisenbahnmetrik, die zur Euklidnorm gehört. Spannender ist, machen Sie mal einen Punkt,
15:06
machen Sie mal einen Kreis mit Radius 1 um den Punkt hier, um den Punkt null und halb. Wo kommen Sie jetzt hin, wenn Sie einen Kilometer weit fahren? Na ja, auf der Strecke, wo Sie
15:21
drauf sind, können Sie einen Kilometer weit fahren, bis hier. Natürlich können Sie noch über Paris fahren und dann kommen Sie aber nur noch einen halben Kilometer aus Paris raus. Das heißt, die Kugel sieht so aus, das ganze Ding plus der Wurm voranzutreten. Ich habe in der letzten Vorlesung gesagt, beim Begriff Kugel müssen
15:43
wir ein bisschen flexibel werden. Das ist halt auch eine Kugel, je nachdem, wie man misst. Das ist eine Kugel in der französischen Eisenbahnmetrik, die zur 2 Nr 2 gehört, um den Punkt 0,5 null mit Radius 1. Soweit zu den Totalgrundbegriffen. Bis jetzt haben
16:12
wir einen Abstand. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, was man mit so einem Abstand alles machen kann. Mit einem Abstand kann man sehr viel machen. Wie gesagt, die Grundidee
16:21
ist jetzt, Sie müssen alle unsere grundlegenden Begriffe aus der ANA 1 zumindest in den RD retten und dann werden Sie jetzt gleich in den beliebigen metrischen Raum retten. Dann haben wir sie auch im RD. Was heißt das? Anfangen will ich mit Eigenschaften, die Mengen haben können, denken Sie an Intervalle, also Beschränktheit, offen,
16:45
abgeschlossen und solche Sachen zu übertragen auf allgemeine metrische Räume. Man kann, ja und mit diesen Hilfsmitteln werden wir dann uns über Konvergenz unterhalten,
17:00
vielleicht gleich so vorneweg. Man kann das alles auch noch ein weiter treiben. Man kann das alles noch ein weiter treiben und auch noch auf den Abstand verzichten und axiomatisch nur noch festlegen, was eine offene Menge ist. Wenn man das tut, kann man auch noch Analysis machen. Bisschen mühsamer geht auch. Gehen einige liebgewonnene Eigenschaften,
17:21
wie Eindeutigkeit des Grenzwerts über die Wuppe, aber egal, es geht. Will ich hier nicht machen, ist ein Werbeblock für die Veranstaltung Topologie, Wahlpflichtbereich Bachelor üblicher Weise. Das ist dann das Ganze bis zum Exzess getrieben. Mit wie wenig Material gibt es noch
17:41
einen Begriff, der einigermaßen so was ist wie Konvergenz. Das ist die Topologie, ein Bereich der Mathematik, der sich mit Eigenschaften von Mengen beschäftigt. Das Grundbegriff, der Begriff offen ist und deswegen heißt jetzt auch dieses Kapitel topologische
18:02
Grundbegriffe. Also wir beschäftigen uns mit den Dingen, auf denen die Topologie aufbaut. Ich werde, wir werden hier von der Topologie sonst nichts mehr sehen, weil wir eben immer eine Metrik im Hintergrund haben und wenn sie eine Metrik haben, dann ist es sozusagen
18:26
später für die Topologie, ist das ein schöner Spezialverband. Und in dem bewegen wir uns, habe ich zur Erklärung, wo dieser Name herkommt, da kommt eben dieser Name her. In dem ganzen
18:42
Abschnitt will ich nicht jedes Mal dazu schreiben, ist M mit D irgendein metrischer Raum. Für die Vorstellung, nehmen Sie R mit Betrag oder nehmen Sie R3 mit einer 2-Norm oder wer Bock hat, nehmen Sie die Menge aller Häuser in Darmstadt mit der diskreten Metrik. Aber für die
19:06
Vorstellung ist natürlich irgendwas gut, wo man sich auskennt und dann werden Sie auch feststellen, alle Begriffe, die ich Ihnen jetzt bringe, sind Verallgemeinerungen dessen, was wir als R kennen und fallen dann dort richtig zusammen. Der zentrale Begriff, der
19:25
jetzt auch schon oft gefallen ist, ist der von einer Kugel. Was brauchen wir für eine Kugel? Für eine Kugel brauchen wir einen Mittelpunkt, nenne ich mal x0 und ein Radius R größer 0. Was ist dann eine Kugel? Ich bezeichne die mal mit U epsilon von x0. U epsilon und R passen nicht
19:50
gut zusammen. UR von x0. Also die Kugel um x0 mit Radius R. Logischerweise sind alle die Punkte in x, deren Abstand zu x0 weniger ist als der Radius. Naja, haben wir jetzt alle
20:03
Hilfsmittel da, um das hinzuschreiben. Der Abstand von x zu x0 ist kleiner als der Radius. Das ist eine Kugel. Es ist sogar eine spezielle Kugel. Es ist eine sogenannte offene Kugel. Warum? Naja, wir haben, wenn Sie das Ganze sich in R oder in R3 vorstellen oder in R2,
20:25
ich habe geschrieben Abstand strikt. Kleiner R ist also der Kreis oder die Kugel ohne den Abstand. Deswegen offene Kugel. Es ist eine offene Kugel um x0 und x0 nennt man natürlich
20:41
dann Mittelpunkt mit Radius R. So, daraus kann man sich jetzt viele weitere Begriffe ableiten. Zunächst mal auch ein ganz typischer topologischer Begriff, den wir in der
21:07
Umgebung von x, von x0, wenn von der Vorstellung her das x0 schön innen drin in diesem U liegt.
21:21
Also von allen Seiten von U umschlossen ist. Im Englischen heißt es noch viel schöner Umgebung, im Englischen ist Neighborhood, eine Nachbarschaft. Das ist eigentlich ein viel schöneres Wort. Also es muss eine Menge sein, die das x nach allen Richtungen schön einhöht. Was heißt das? Das heißt, es muss eine, egal wie klein, aber es muss eine Kugel geben,
21:45
um das x0, die ganz in U liegt. Also ich nenne eine U eine Umgebung von x, falls es einen Radius gibt, größer 0. Irgendwie ein, der kann sehr klein sein, sodass die Kugel um x0 mit Radius R ganz in U liegt. Also dieser Punkt liegt nicht irgendwie am Rand von U oder irgendwie
22:05
nur so ein bisschen, sondern ganz schön von U umschlossen. Das nennt man eine Umgebung. Und mit diesen Begriffen Kugel und Umgebung können wir jetzt uns an die Begriffe beschränkt, offen und abgeschlossen machen. Also wenn wir eine Teilmenge x von M haben, dann nennt man
22:30
die beschränkt, wenn, so jetzt kann man sich überlegen, wie kann man beschränkt definieren? Beschränkt heißt, geht nicht in so nennliche. Schlecht M ist eine Menge, da gibt es keine
22:41
nennliche. Das einzige was wir haben sind Kugeln. Hier können sie beschränkt beschreiben durch Kugeln. Ganz einfach, es gibt irgendeine große Kugel, wo das Ding drin liegt. Also es gibt irgendeinen Radius und es gibt irgendeinen Mittelpunkt, sodass wir durch Großpuppen des
23:01
Radiuses diese Menge irgendwie ganz fassen. Also es muss ein x0 in M geben und es muss Radius größer 0 geben, sodass diese Menge x in der Kugel um x0 mit Radius R drin ist. Einfache Definition von beschränkt. Sie nehmen sich einen Mittelpunkt, machen den Radius größer und die Menge ist beschränkt, wenn sie sie irgendwann haben. Was bedeutet
23:28
es, dass eine Menge offen ist? Jeder von Ihnen weiß, was ein offenes Intervall ist. Aber was ist die Essenz des Offenseins? Die Essenz des Offenseins ist, es ist kein Rand dabei.
23:41
Ja, was ist ein Rand? Kommen wir auch noch zu. Das richtige Bild ist das gerade schon angesprochene. Eine Menge ist offen, wenn jeder Punkt kuschelig drin liess. Wenn jeder Punkt ganz von der Menge umschlossen ist. Also diese Bedingung für die Umgebung,
24:00
dass es eine Kugel geben muss, die um den Punkt drumrum liegt, die muss jetzt für jeden Punkt der Menge gehen. Wir nennen so eine Menge offen, falls egal welchen Punkt sie sich aus der Menge rausnehmen, also für alle x sind x, sie so eine Kugel finden, die noch in der Menge drin liegt und diesen Punkt enthält. Also es ein Radius größer 0 gibt, sodass die Kugel
24:24
um x mit Radius R ganz in der Menge x liegt. Das ist genau das, was wir von einem offenen Intervall kennen, wenn sie ein offenes Intervall haben. Egal welchen Punkt sie sich hier rausnehmen, sie finden immer eine Kugel. Eine Kugel in R ist einfach ein Intervall. Sie finden
24:42
immer noch ein Intervällchen drumrum, das ganz drin liegt. Das Intervällchen wird natürlich, wenn sie mit ihrem Punkt gegen den Rand gehen, immer kleiner. Das ist aber ja auch okay. Die Definition verlangt, für jeden Punkt muss es ein Radius geben. Sie dürfen jedem Punkt seinen Radius auf den Leib schneidern. Jeder Punkt darf einen anderen Radius haben, aber um
25:01
jeden Punkt muss es ein Kügelchen geben, das noch in der Menge liegt. Dann nennt man Menge offen. Jetzt kommt abgeschlossen. Denken Sie an abgeschlossenes Intervall. Da sind jetzt
25:21
alle Ränder dabei. Jetzt kann man lang überlegen. Wir haben das in der 1 definiert. Wir haben gesagt, eine Menge ist abgeschlossen, wenn der Grenzwert von jeder Folge dazugehört. Wenn jede Folge, die da drin liegt und die im ganzen Raum konvergiert, alle Grenzwerte
25:41
müssen dazugehören. Das ist ein bisschen blöd, weil wir wissen auch nicht, was Konvergenz heißt. Man kann es sich an der Stelle zum Glück einfach machen und sich wenig Arbeit machen. Stellen Sie sich mal eine abgeschlossene Menge in R und schauen Sie sich das an,
26:01
was übrig bleibt. Also R ohne diese abschlossene Menge. Das ist dann offen. So ist genau die Definition. Man nennt eine Menge abgeschlossen, wenn der Rest offen ist. Also falls das Kompliment davon, x-Kompliment, das ist der ganze Raum ohne das x, wenn das offen ist. In dem Sinne
26:22
sind offen und abgeschlossen duale Begriffe zueinander. Eine Menge ist genau dann offen, wenn ihr Kompliment abgeschlossen ist. Es geht natürlich jetzt auch andersrum. Wenn Sie eine offene Menge haben und schauen sich an M ohne x, also wenn x offen ist, dann ist M ohne x abgeschlossen. Wenn M ohne x offen ist, ist es x abgeschlossen.
26:45
So, das sind ganz schön viele Begriffe. Ich hoffe aber, die sind irgendwie intuitiv. Wir haben sie alle zurückgespielt auf den Begriff einer Kugel und damit auf unsere Metri. Kurz zwei Beispiele, mit denen wir viel zu tun haben. Zunächst möchte ich
27:15
mal rechtfertigen. Hier vorne in der Definition habe ich dieses Gebilde UR von x0 eine offene
27:22
Kugel genannt. Wenn das irgendwie Sinn haben soll, wäre es schön, wenn die auch im Sinne unserer Definition da offen ist. Sonst wäre das eine ziemlich bescheuerte Namensgebung. Also prüfen wir das mal nach. Also ich behaupte, die offene Kugel um x0 mit Radius R ist
27:41
tatsächlich oft. Hört sich jetzt total bekloppt an, aber ist ja so erstmal nicht klar. Was muss ich dazu tun? Also ich führe Ihnen das zum einen vor, damit diese Nomenklatur sinnig ist. Das könnten Sie mir auch glauben, aber ich führe Ihnen das vor allem vor als Blaupause für wie zeige ich, dass eine Menge offen ist. Wie zeige ich, dass eine Menge offen ist? Nach
28:04
Definition, ich muss für jeden Punkt aus der Menge eine Umgebung finden, also eine Kugel finden, die ganz in der Menge drin liegt und um diesen Punkt x drumherum ist. Also nehme ich mir irgendeinen Punkt her, nehme also irgendeinen Punkt aus der Kugel um x0 mit Radius R her. Man
28:29
muss sich zeigen, darum finde ich noch eine Kugel, die ganz in dieser Kugel liegt, Kugel in Kugel. Was ist die Idee vom Beweis? Erstmal ein Bild malen, hier ist x0,
28:41
das ist meine Kugel, hier ist mein x. Na ja, wie sieht jetzt die Kugel aus, die um x drumherum liegt und noch ganz drin ist, sinnigerweise irgendwie so. Was kann ich hier als Radius nehmen? Ich habe den Abstand von x zu x0, der ist kleiner als der große Kugelradius und
29:06
der Radius um mein x ist natürlich genau das, was fehlt. Also das, was der Abstand von x zu x0 kleiner ist als der große Kugelradius. Genau das machen wir jetzt. Also wir wissen,
29:21
der Abstand von x zu x0, der ist dann kleiner als R. Nach Definition, die offene Kugel um x0 mit Radius R enthält genau die Punkte, wo dieser Abstand kleiner ist als R. So, jetzt nehmen wir uns diese Differenz zwischen dem Radius R und diesem Abstand. Also die
29:44
nenne ich mal Rho. Das R schon verbraucht, das muss man zum griechischen R greifen. Also R minus diesen Abstand von x zu x0, das ist jetzt eine positive Zahl, weil R war ja größer als der Abstand. So, wenn ich mir jetzt die Kugel um x mit diesem Radius R anschaue, dann behaupte
30:02
ich, die liegt ganz in der Kugel um x0 mit Radius R drin. Also ich zeige die Kugel um x mit Radius R liegt ganz in der Kugel um x0 mit Radius R. Und dann, wenn ich das habe,
30:21
dann ist meine Menge off. Weil dann habe ich für jedes x eine Kugel gefunden, um das x die ganz drin liegt. So, also, um das zu zeigen, ist eine Mengeninklusion. Also wenn wir das haben, dann sind wir fertig. Ist eine Mengeninklusion, also nehmen Sie sich irgendein Z aus der linken
30:42
Menge her und zeigen das jetzt in der rechten. Was muss ich tun, um zu zeigen, dass das in der rechten Menge drin ist. Die rechte Menge enthält alle die Punkte, deren Abstand zu x0 kleiner ist als R. Also schauen wir uns den Abstand von x0 zu z an und zeigen, dass der kleiner ist als R. Der Abstand von x0 zu z, über den weiß ich nichts. Ich weiß was über den Abstand von z zu
31:06
x und ich weiß was über den Abstand von x zu x0. Es schreit nach der Dreiecksungleichung, weil wir brauchen ein x. Also bauen wir uns mal ein x ein. Nach der Dreiecksunggleichung ist der Abstand von x0 zu z kleiner als der Abstand von x0 zu x plus der Abstand von x zu z.
31:26
Der Abstand von x0 zu x, der ist kleiner als R, weil x liegt hier in der offenen Kugel um x0 mit 1. Der Abstand von x zu z, den lassen wir stehen. Und der Abstand von x zu z, der ist kleiner als R,
31:53
weil z liegt in der Kugel um x mit radius R. So Abstand von x0 zu x plus R,
32:02
das ist im Wesentlichen gleich R. So war das roh gemacht. Also steht hier gleich R und alles ist gut. Das heißt nämlich, dass dann z näher als R an x0 ist, also in der Kugel um x0 mit
32:20
radius R. Und damit ist das Ding offen. Wenn es eine offene Kugel gibt, sollte es auch eine abgeschlossene geben. Die abgeschlossene Kugel sieht auch so aus, wie man sie erwartet. Das sind
32:43
alle die x mit Abstand zu x0 mit Abstand kleiner gleich R. Also wir schauen uns an, die Menge aller x in M, sodass der Abstand von x zu x0 kleiner gleich R ist. Wenn Sie in R2 denken
33:03
und den Abstandsbegriff ganz normal über die ökologische Norm nehmen, dann ist das genau der Kreis mit radius R inklusive Kreislinie. Das ist die abgeschlossene Kugel, der geben wir auch einen Namen, weil die taucht in der Volllösung auch noch häufiger auf. Die nenne ich K von R x0. Also das ist die abgeschlossene Kugel um x0 mit radius R.
33:40
Übrigens auch der Grund, warum bisher die Kugel so komisch U hieß und nicht K. Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, wie soll ich eine Kugel U nennen. K wäre sinniger, aber K brauchen wir hier. Erstens und zweitens, dieses U ist eine Reminiszenz an den Begriff der Umgebung. Die einfachste Umgebung von einem Punkt ist eine Kugel, eine offene Kugel. Daher kommt das
34:08
U, die einfachste Umgebung von einem Punkt ist eine Kugel. Also U, R x0, die Kugel ohne Rand mit Abstand kleiner R, K, R x0, die Kugel mit Rand kleiner gleich R. Nennen wir eine abgeschlossene
34:23
Kugel. Das Ding ist natürlich auch abgeschlossen. Das ist im Skript auch nochmal ausgeführt. Ich will es jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Was müsste man tun, um zu zeigen, dass das Ding abgeschlossen ist? Nach Definition bleibt einem nicht viel
34:42
übrig, als das Kompliment anzugucken. Also alle Punkte des metrischen Raums, deren Abstand zu x0 größer als R ist, um zu zeigen, dass das eine offene Menge ist. Das gibt nochmal einen offenen Beweis. Der sieht fast genauso aus, wie der gerade eben. Deswegen habe ich jetzt auch keine Lust hier nochmal vor zu x. Man muss wieder eigentlich zeigen, dass eine
35:01
Menge offen ist und das macht man genauso wie gerade eben. Nur ist es jetzt die Menge aller Punkte, die außerhalb dieser abgeschlossenen Kugel liegen. Also auch hier das Ding trägt seinen Namen zurecht. Die abgeschlossene Kugel ist tatsächlich abgeschlossen. So, damit haben wir
35:24
Begriffe von offen und abgeschlossen. Das sieht auch alles relativ harmlos und nett aus. Ich will gerade deswegen, weil es so harmlos und nett aussieht, zwei Warnungen loswerden mit den typischsten Fehlern in dem Zusammenhang. Der eine Fehler ist eigentlich relativ plump und
35:42
offensichtlich und passiert trotzdem manchmal und der andere ist sehr subtil und auf den will ich insbesondere hinweisen. Fangen wir mit den Plumpen an und dieser plumpe Fehler lässt sich schön in einen in einen Merksatz packen, der von einem von Karl-Heinrich-Haufmann
36:07
stammt oder zumindest habe ich es von dem gelernt. Prof bei uns am Fachbereich schon lange emeritiert, gut über 80 und der hat das ganz in die schönen kurzen vier Worte gefasst. Mengen sind keine Türen. Was ist damit gemeint? Eine Tür ist entweder auf oder zu. Eine Menge
36:29
ist nicht entweder offen oder abgeschlossen, auch wenn das immer wieder immer wieder gern passiert. Der Klassiker, die Menge ist nicht offen, also ist sie abgeschlossen. Fertig. Und so oft man das liest, so oft fragt man sich, wie kommen die Leute auf die Idee? Jeder von
36:42
ihnen kennt halb offene Intervalle. Intervalle von 0 nicht drin bis 1 drin ist natürlich weder offen noch abgeschlossen. Die meisten Mengen sind weder noch. Die meisten Mengen sind weder offen noch abgeschlossen. In R ist es, aber mit dem R2 ist es noch viel
37:04
da. Nehmen Sie sich so eine Menge her, so einen Kreis, nehmen Sie das Stück Rand dazu, das nächste Stück nicht, hier wieder ein Stück dazu, hier mal ein Punkt Ja. Da können Sie beliebige Mischungen aus offen und abgeschlossen machen. Noch schlimmer, es gibt sogar Mengen, die beide sind, die offen und abgeschlossen sind. Nehmen Sie
37:26
zum Beispiel den ganzen Raum. Im ganzen Raum ist jeder Punkt in einer Kugel enthalten, die im ganzen Raum liegt. Das Kompliment vom ganzen Raum ist leer. Die leere Menge ist wunderbar abgeschlossen, ist wunderbar offen, weil offen bedeutet, um jeden Punkt gibt es eine
37:43
Umgebung. Klar, um jeden Punkt der leeren Mengen gibt es eine Umgebung. Alle Aussagen über die leere Menge waren schon immer super, weil es immer war. Also der ganze Raum ist offen und abgeschlossen, die leere Menge übrigens auch. Im Englischen gibt es dafür das schöne Wort closed und open. Ist wunderbar, kann man wunderbar ins Deutsch übersetzen,
38:04
abgeschlossen. Also gibt es auch, wird sogar noch eine Rolle spielen im Kapitel 6 oder so, offen und abgeschlossene Mengen sind sehr interessant. Also bitte nicht auf die Idee
38:21
kommen, auch wenn es ein schöner Schnellschuss ist, das Ding ist nicht offen, also ist abgeschlossen, nix da. Das sind zwei völlig Sachen, die nix miteinander zu tun haben. Sie sind halt dual zueinander. Also wenn das eine offen ist, ist das Kompliment abgeschlossen und umgekehrt, aber über die einzelne Menge kann man nichts aussagen. So und die zweite Warnung,
38:42
die ist sehr subtil und meiner Erfahrung nach und ich weiß es in meinem Studium, ich weiß es immer wieder, das ist eine Stelle, an der ganz ganz oft Verwirrung auftritt. Deswegen will ich darauf explizit hinweisen. Die Begriffe offen und abgeschlossen hängen massiv davon ab,
39:03
in welchem metrischen Raum man das Zeug anguckt. Eine Menge ist nie für sich selbst offen oder abgeschlossen. Eine Menge ist immer offen als Teilmenge einer anderen. Im Prinzip sollten Sie sich angewöhnen, zumindest jetzt am Anfang so lange, bis dieser Punkt echt für
39:21
Hinterlicht ist und ich werde versuchen, es hier auch zu tun, nie zu sagen, die Menge ist offen. Die Menge ist offen, muss bei allen Ihren Kolleginnen und Kollegen sofort den Reflex auslösen. Wo drin? Also wenn irgendjemand sagt, die Menge ist offen, sagen sie sofort, wo drin? Und Sie gewöhnen sich an, die Menge ist offen in R oder die Menge ist offen in der Kugel mit
39:42
Radius eins um null oder die Menge ist offen in der Menge der n-Kreuz-n-Matrize oder die Menge ist offen in der Menge aller Polynomen. Oder, oder, oder. Aber eine Menge ist immer offen in einer anderen. So wie hier auch, so wie in der Definition. Wir haben einen
40:01
metrischen Raum M und x ist offen in M falls gilt. Und warum das so ist, dass das wirklich ein Unterschied ist, will ich an einem banalen, aber hoffentlich klaren Beispiel zeigen. Also Menge ist offen und abgeschlossen immer relativ zum umgebenden metrischen Raum. Und wenn Sie den
40:25
umgebenden metrischen Raum ändern, dann kann sich auch die Qualität offen oder abgeschlossen ändern. Gehen wir zu dem Beispiel von, na ja zumindest fast zu dem Beispiel von gerade eben zurück, nehmen Sie es halb offen, Intervall null dabei, eins nicht. Wenn Sie das in R angucken,
40:48
dann ist das natürlich nicht offen. Warum ist nicht offen? Weil es einen Punkt gibt, der dazugehört, um den Sie keine Kugel packen können, nämlich die Null. Egal wie klein Sie Ihre Kugel um null machen, die ragt immer aus der Menge raus. Null ist nicht schön
41:04
eingepackt in der Menge, also ist das Ding nicht. Das Ding ist auch nicht abgeschlossen. Argumentation wie in der ANAE, also wir können jetzt entweder über die ANA1 argumentieren, wenn Sie mir im Moment glauben, dass der abgeschlossene Begriff mit dem ANA1 abgeschlossene Begriff übereinstimmt, was ich tue. Weil eins ist ein Grenzwert von Erfolg darin, ist aber nicht
41:23
dabei. Sie können es aber auch mit der Definition machen. Schauen Sie das Kompliment an. Zum Kompliment gehört die eins dazu und da kriegen Sie keine Kugel drauf. Also das Kompliment ist nicht offen. Das Ding ist nicht offen und nicht abgeschlossen. So, jetzt ändern wir den metrischen Raum. Nehmen wir die gleiche Menge und schauen uns das an
41:44
in den nicht negativen reellen Zahlen. Das ist ein metrischer Raum. Warum? Dann immer Sie eine Teilmenge von dem metrischen Raum nehmen, ist der in dem metrischen Raum, über die induzierte Metrik. Sie schränken einfach die Metrik darauf ein. So, das Ding
42:00
ist immer noch nicht abgeschlossen, weil in der eins haben Sie das gleiche Problem wie vorher. Das Kompliment davon ist jetzt das Intervall von eins inklusive eins bis unendlich. Das ist keine offene Menge. Also das Ding ist nicht abgeschlossen. Aber das Ding ist offen. Denn wie sieht eine Kugel um Null in diesem metrischen Raum aus? Das sind alle die
42:32
Punkte in Null unendlich, deren Abstand zu Null kleiner ist als R. Und die Menge aller der Punkte in Null unendlich, deren Abstand zu Null zum Beispiel kleiner ist als ein halb,
42:45
gehört da wunderbar dazu. Null, also Sie finden eine Kugel um Null, eine Kugel in diesem metrischen Raum, die ganz darin liegt. Also ist das eine offene Menge. Für die anderen finden Sie eh eine. Die sind einfach. Aber Sie finden auch eine um Null, weil der metrische Raum jetzt
43:04
ein anderes ist. Sozusagen die negativen Zahlen, die vorher gestört haben, die sind jetzt in Null einmal geschmissen und gehören nicht mehr zum Universum. Und deswegen können die nicht mehr stören. So und jetzt machen Sie den gleichen Trick nochmal. Gucken Sie sich
43:24
wieder die gleiche Menge an. Aber als metrischen Raum nehmen Sie jetzt die Menge selber. Dann ist das Ding abgeschlossen. Dann ist das Ding offen und abgeschlossen. In Null eins. Also in diesem halboffenen Intervall Null eins ist die Menge Null halboffenen Intervall Null eins
43:43
offen und abgeschlossen. Der metrische Raum ist immer in sich selbst offen und abgeschlossen. Also was ich damit zeigen will, ist Sie können diese Eigenschaften offen und abgeschlossen ändern, wenn Sie den umgebenden metrischen Raum ändern. Und das sorgt extrem oft für Verwirrung und ist an manchen Stellen ganz subtil versteckt. Und damit kann man sich Mords
44:02
in die Tinte reiten, wenn man darauf nicht aufpasst. Und deswegen mein Aufruf. Jeder Mensch, der irgendwas von ist offen sagt, kriegt sofort ein Wo drin. Und wenn Sie das dann ein halbes Jahr lang gemacht haben, dann ist das irgendwann so verinnerlicht. Dann darf man auch wieder schlampern. Natürlich schlampert man oft, weil in 80 Prozent der Fälle ist total klar
44:25
Wo drin. Wenn die ganze Aufgabe im R3 abgeht und man die ganze Aufgabe im R3 ist, dann hat man nach einer Dreiviertelstunde keine Lust mehr zu sagen offen in R3. Ist ja eh klar. Und dann lässt man es auch wieder weg. Und mir wird es auch hundertfach passieren, dass ich es weglasse, weil ich das schon so gewohnt bin. Aber es ist eigentlich
44:42
geschlampert. Dazu ganz viel erzählt, weil es was ist, was immer wieder hängt. Und hier kommt noch eine Übungsaufgabe, die Ihnen helfen kann, das noch ein bisschen genauer zu verstehen und die gleichzeitig ein Kriterium dafür gibt, wann ist denn jetzt so eine Menge
45:01
offen oder abgeschlossen in so einem seltsameren, metrischen Raum. Also das ist die Situation, in der wir da in diesem 2-3-B sind. Wir haben einen großen, metrischen Raum. Und also wenn Sie in dem Beispiel oben sind, das M ist das R, das X ist das Null unendlich.
45:26
Und jetzt schauen Sie sich davon eine Teilmenge Y an. Also Y Teilmenge X. Und diese Y ist dann in X, da ist jetzt der Punkt, offen. Also wir haben das große R. Wir haben den
45:50
metrischen Teilraum davon und jetzt diese Teilmenge Y. Und wir wollen wissen, wann ist diese Y in X offen oder abgeschlossen. Da gibt es ein schönes Kriterium. Das ist genau dann in X offen, wenn es eine Teilmenge O von M gibt. O offen in M, sodass Sie Ihre
46:11
Menge Y schreiben können, als der Anteil von O, der in X liegt. Im Beispiel von oben,
46:21
diese Menge, unser halboffenes Intervall 0,1, ist offen in den nicht negativen reellen Zahlen. Was müssen wir tun, um es hiermit nachzuweisen? Wir müssen eine offene Menge in R finden, sodass Sie dieses Intervall, halboffenes Intervall 0,1, als Schnitt schreiben können, diese offene Menge mit den nicht negativen Zahlen. Nehmen Sie als O zum Beispiel das offene Intervall von minus 1 bis 1. Das offene Intervall von
46:44
minus 1 bis 1 ist offen in R. Wenn Sie es mit den nicht negativen Zahlen schneiden, kommt genau dieses halboffene Intervall raus. Dementsprechend ist dieses halboffene Intervall in den nicht negativen Zahlen offen. Gleiches Ergebnis für abgeschlossen.
47:03
Also eine Menge ist abgeschlossen in X. Genau dann, wenn es eine abgeschlossene Teilmenge von M gibt, A abgeschlossen in M, sodass Sie hier Y schreiben können, als A Schnitt X. Man nennt das die Spur einer Menge. Das ist aber auch Topologie,
47:25
will ich jetzt gar nicht näher drauf gehen. Entscheidend ist, Sie kriegen damit ein Kriterium, wie Sie in solche induzierten Topologien auf Teilmengen, offen und abgeschlossen, übertragen können. Und ich denke, wenn Sie versuchen oder wenn Sie das beweisen, dann gibt das auch so ein bisschen mehr Gespür für dieses subtile Problem. Offen
47:44
ist immer eine relative Sache und abgeschlossen auch. Das wäre jetzt meine Erzählung vor der Pause. Noch mal 10 Minuten Pause. Und dann schauen wir uns weiter Eigenschaften
48:01
von offenen und abgeschlossenen Mengen an. So, dann würde ich gern in den zweiten Teil
48:22
einsteigen und ein bisschen auf diesen Begriffen offen und abgeschlossen rumkneten, weil die jetzt die Grundlage dafür sind, noch verschiedene Dinge, die bisher immer mal wieder angeklungen sind, die wir bisher noch nicht definieren konnten, zu definieren. Also insbesondere zum Beispiel, was ist ein Rand, was ist ein Randpunkt und so weiter. Damit
48:47
wollen wir uns jetzt auseinandersetzen und der erste Schritt dahin ist eine wesentliche schöne Eigenschaft von abgeschlossen und offenen Mengen. Nämlich, dass man die relativ frei vereinigen und schneiden kann, ohne die Eigenschaft offen abgeschlossen zu verlieren.
49:08
Also, die genaue Formulierung ist, i sei jetzt irgendeine beliebige Indexmenge. Wir sehen Ja, so erst recht nicht, aber so. Ja, nee. Komm her. So. Also, i sei irgendeine beliebige
49:31
Indexmenge, also irgendwas, womit sie durchindizieren können. Die kann endlich abzählbar, überabzählbar sein. Ist mir völlig egal. Und dann sei x i Teilmenge m offen für jedes
49:47
i in i. Also, diese Indexmenge dient nur dazu zu sagen, sie nehmen irgendeine Stapel offene Mengen und zwar egal wie viele. Ähnlich viele, abzählbar viele, überabzählbar viele. Mir völlig wurscht. So. Und dann behaupte ich, wenn sie die jetzt alle nehmen und alle vereinigen,
50:08
ist das Ergebnis immer wieder offen. Also, beliebige Vereinigungen von offenen Mengen Vorsicht, mit dem Schnitt geht es nicht ganz so gut. Da können sie nur zwei nehmen. Das ist
50:25
der zweite Teil. Oder nein, nicht nur zwei, sondern endlich viele. Also, wenn sie zwei Teilmengen von m haben, die beide offen sind, dann ist auch der Schnitt von x1 und x2 offen. Ja, das können sie jetzt natürlich sofort induktiv hochziehen. Ja, also können sie
50:41
natürlich auch n offene Mengen schneiden und haben wir noch was offenes. Also, eine endliche Anzahl von offenen Mengen schneiden gibt was Offenes. Eine beliebige Anzahl von offenen Mengen vereinigen gibt was Offenes. So. Abgeschlossen ist immer der duale Begriff zu offen durch Komplementbildung. Dementsprechend gilt sozusagen von der
51:02
Faustregel her, wenn irgendwas für offen gilt, dann gilt das Komplement davon verabgeschlossen. Dementsprechend können sie diesen Satz für abgeschlossene Mengen so über all diese abgeschlossenen Mengen abgeschlossen. Und wenn sie endlich viele,
51:23
also zwei abgeschlossene Mengen haben, dann ist die Vereinigung über diese beiden abgeschlossen. Also, endliche Vereinigungen abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen. Beliebige Schnitte von abgeschlossenen Mengen sind abgeschlossen. Bevor wir das beweisen,
51:47
eine kurze Bemerkung, die eigentlich schon klar ist, aber ich will sie noch durch ein ein bisschen unterfüttern, ich würde mir nicht die Mühe machen, den Satz so akribisch zu unterscheiden zwischen beliebigen und endlichen. Es geht tatsächlich nicht mehr. Also wenn sie
52:05
unendlich viele offene Mengen schneiden, kann es passieren, dass das was rauskommt nicht mehr offen ist. Und wenn sie unendlich viele abgeschlossene Mengen vereinigen, kann es auch passieren, dass das Ergebnis nicht mehr abgeschlossen ist. Hier ist
52:20
das Beispiel. Und weil wir ja unser Dauerbeispiel mit dem halben offenen Intervall von 0 bis 1 haben, bleiben wir dabei. Dieses halbe offene Intervall kann ich zum einen schreiben als ein abzählbaren Schnitt von offenen Mengen. Sie können das sehen als den Schnitt über alle Mengen der Form minus eins durch N. Sie nehmen die offenen Intervalle von minus eins
52:40
durch N bis eins und schneiden die alle miteinander. Und was kommt raus? Die Intervalle werden immer kleiner. Wenn sie miteinander schneiden, kommt das raus, was in allen drin liegt. Und das ist das halbe offene Intervall von 0 bis 1. Das heißt, sie schneiden lauter offene Mengen und das Ergebnis ist nicht mehr offen. Da oben geht es also tatsächlich nicht mehr. Endlich viele
53:02
offene Mengen können sie schneiden, aber nicht unendlich viele. Das können sie schon machen, aber dann können sie nicht mehr sicher sein, dass was offenes rauskommt. Dieses halbe offene Intervall können wir auch schreiben als eine abzählbare Vereinigung von abgeschlossenen Mengen. Und zwar nehmen sie das abgeschlossene Intervall von 0 bis N durch N plus 1. Also 0 in
53:26
halb, 0 2 drittel, 0 3 viertel, 0 4 fünftel und so weiter. Die abgeschlossenen Intervalle nehmen sie alle zusammen. Was kommt raus? E 0 und rechts kriegen sie alles bis zu 1, aber die 1 nicht mehr. Also das halbe offene Intervall von 0 bis 1. Damit haben sie eine
53:43
unendliche Vereinigung von abgeschlossenen Intervallen und das Ergebnis ist nicht mehr abgeschlossen. Also da geht tatsächlich nicht mehr, aber alles andere geht. So, das alles andere geht machen wir jetzt. Beweis von 2 5. Fangen wir mit dem A für offen an. Also
54:05
wir wollen zeigen, wenn sie irgendwelche offenen Mengen haben, egal wie viele und sie bilden deren Vereinigung, ist das Ergebnis wieder offen. Also unser Ziel ist zu zeigen, diese Vereinigung über x i ist offen. Was müssen wir dafür tun? Also wir haben unsere beliebig
54:27
vielen offenen Teilmengen von M. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen uns irgendeinen Punkt aus dieser Vereinigung rausnehmen und zeigen, dass der da schön kuschlig drin liegt, dass es eine Kugel um ihn gibt, die noch ganz in dieser Vereinigung liegt. Also wir nehmen uns ein x 0 aus dieser Vereinigung her. Was heißt das,
54:47
dass x 0 in der Vereinigung ist? Das heißt, es liegt in irgendeinem x i. Irgendwie muss es die Vereinigung ja reingekommen sein. Also es gibt irgendein Index i 0, so dass dieses x 0 in der Menge x i 0 drin liegt. So, jetzt ist x i 0 aber offen. x i 0 ist eine offene
55:09
Menge. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein Radius epsilon größer 0, so dass die Kugel, die epsilon Kugel um x 0, also die Kugel um x 0 mit Radius epsilon, ganz in
55:21
x i 0 drin liegt. Das ist genau offen. Offen bedeutet, jeder Punkt hat eine Kugel, die drum liegt, die drum ist und noch ganz in der Menge liegt. Na ja, aber wenn diese Kugel ganz in x i 0 liegt, liegt sie natürlich auch in der Vereinigung. Die Vereinigung enthält alles, was irgendeiner enthält. Also ist diese Kugel, diese offene Kugel
55:44
um x 0 mit Radius epsilon, enthalten in der Vereinigung über alle x i und damit sind wir schon fertig. Damit haben wir jetzt gezeigt, die Vereinigung über alle i aus i über x i ist offen, weil wir haben um jeden Punkt eine Kugel gefunden, die ganz drin liegt. Warum gilt dasselbe für die abgeschlossenen? Können Sie
56:11
jetzt ein Argument fahren mit den Komplimenten und zeigen, dass die offen sind. Das geht sehr fix. Also jetzt für abgeschlossen sein x i Teilmenge m jeweils abgeschlossen
56:28
für i aus i. Das Schöne ist, wir können das auf das gerade gezeigte zurück spielen, indem wir die neumorgenschen Regeln für die Komplimentbildung benutzen, die ich hoffe bekannt sind. Was müssen wir uns anschauen? Wir müssen uns anschauen den
56:44
Schnitt i aus i über x i. Von dem wollen wir zeigen, der ist abgeschlossen. Wann ist das Ding abgeschlossen? Das Ding ist abgeschlossen, wenn das Kompliment davon offen ist. Also schauen wir uns das Kompliment an. Was ist das Kompliment von einem Schnitt? Das Kompliment von einem Schnitt ist die Vereinigung der
57:03
Komplimente. Also ist die Vereinigung i aus i über die Komplimente von x i. So x i ist abgeschlossen, also ist das Kompliment von x i off. Was hier also steht, ist eine Vereinigung von offenen Mengen. Also ist das ganze Ding offen. Haben wir gerade gezeigt, beliebige Vereinigungen von offenen Mengen sind offen.
57:24
Wenn das Ding da aber offen ist, dann ist, das ist ein Kompliment von was ist offen, also ist der Schnitt abgeschlossen. Abgeschlossen bedeutet genau das Kompliment ist offen. Genauso für die endlichen
57:44
Schnitte von offenen und endlichen Vereinigungen von abgeschlossenen Mengen. Da muss man bei den offenen ein bisschen anders argumentieren. Die abgeschlossenen kriegt man dann wieder mit Kompliment sofort. Also warum kann man offene Mengen schneiden und sie bleiben offen, solange es endlich viele
58:03
sind? Nehmen sie sich zwei offene Teilmengen von M her. Nehmen sie sich ein x0 aus dem Schnitt und jetzt müssen wir also um dieses x0 eine Kugel finden, die ganz im Schnitt von x1 und x2 drin ist.
58:22
Wir wissen zunächst mal x0 liegt sowohl in x1 als auch in x2. x0 liegt jetzt in x1 und in x2 und x1 und x2 sind beide offen. Also gibt es zwei Radien epsilon 1 und epsilon 2, beide größer 0, sodass die Kugel um x0 mit radius epsilon 1
58:48
ganz in x1 liegt und die Kugel um x0 mit radius epsilon 2 ganz in x2 liegt. Weil x1 und x2 offen sind. Eine von den beiden wird jetzt im allgemeinen größer
59:05
sein als die andere. Wenn sie die kleinere von den beiden nehmen, also wir nehmen die Kugel mit radius minimum von epsilon 1 und epsilon 2, dann ist die in x1 enthalten und in x2, je nachdem wie es der kleinere ist. Und das heißt, die
59:26
liegt in x1 Schnitt x2 und wir haben eine Kugel gefunden, um x0 die ganze mit x1 Schnitt x2 drin liegt und damit ist das Ding offen. Wenn man sich den Beweis anguckt,
59:41
sieht man auch, dass der zumindest schief geht, wenn sie unendlich viele offene Mengen haben. Den gleichen Beweis können sie natürlich mit 17 Mengen machen. Dann haben sie 17 Radien, nehmen sie das kleinste davon und der liegt in allen drin. Aber wenn sie unendlich viele Mengen haben, dann kann es halt sein, dass dieses,
01:00:00
das Minimum zum Infimum machen. Und dieses Infimum kann halt dummerweise 0 sein. Und das ist auch passiert, sieht man da oben in dem Beispiel. Kann eben passieren, dass das Infimum nicht ist. So, also jetzt zur Vollständigkeit halber noch das Gleiche für abgeschlossene
01:00:21
Mengen. Das heißt das Gleiche, das Duale, das entsprechende für abgeschlossene Mengen. Wenn x1, x2 abgeschlossene Teilmengen sind, dann wollen wir zeigen, dass x1 vereinigt, x2 abgeschlossen ist. Abgeschlossen heißt, das Kompliment ist offen. Also schauen sich das
01:00:47
Kompliment an. Nach dem Morgen ist das Kompliment von der Vereinigung der Schnitt der Komplimente, also x1 Kompliment, Schnitt x2 Kompliment. x1 ist abgeschlossen, also ist das da offen. x2
01:01:03
ist abgeschlossen, also ist das da offen. Damit ist das Ganze offen und damit ist x1 vereinigt x2 abgeschlossen. Gleiches Argument wie vorher. So, also was haben wir? Wir haben gesehen, beliebige Vereinigungen von offenen Mengen sind offen. Beliebige Schnitte von
01:01:27
abgeschlossenen Mengen sind abgeschlossen. Und jetzt kommt was, was man in so einer Situation, wenn man es oft genug gesehen hat, automatisch macht. Die Situation haben Sie schon mehrfach
01:01:40
erlebt. Nicht in der Anna, aber in der Ella. Was macht man aus der Aussage, beliebige Schnitte von Untervektorräumen sind wieder Untervektorräume. Daraus macht man die lineare Hülle. Die lineare Hülle ist der Schnitt aller Untervektorräume, die größer sind als meine Mengen.
01:02:04
Und dieses Verfahren ist ein ganz allgemeines, die sogenannte Hüllenbildung. Wann immer man sowas hat, ich habe eine Struktur und beliebiger Schnitt von der Struktur ist wieder die Struktur, dann kann man sofort einen Erzeuger machen. Beliebige Schnitte von Untergruppen sind Untergruppen. Puff, erzeugter Untergruppen. Sehen wir das Gleiche. Machen wir hier auch.
01:02:23
Beliebige Schnitte von abgeschlossenen Mengen sind abgeschlossen. Was können wir damit definieren? Damit können wir definieren, die kleinste abgeschlossene Obermenge von einer Menge. Sie nehmen einfach, Sie haben irgendeine Menge. Sie suchen die kleinste abgeschlossene Menge, wo das Ding drin liegt. Was machen Sie? Sie nehmen alle abgeschlossene Obermengen,
01:02:41
das sind ganz schön viele, ist egal. Dann nehmen Sie die alle und machen davon einen großen Schnitt. Das Ergebnis ist abgeschlossen und Sie haben die kleinste abgeschlossene Obermengen. Sogenannte abgeschlossene Hülle. Das gleiche können Sie von unten mit den offenen machen. Sie haben irgendeine beliebige Menge und suchen die größte offene, die drin liegt. Nehmen Sie alle offenen, die drin liegen. Machen Sie die Vereinigung davon.
01:03:05
Die Vereinigung davon ist immer noch eine Teilmenge von Ihrer Menge, weil Sie haben nur Teilmengen genommen. Ist aber offen, weil es die Vereinigung von offenen Mengen ist und Sie haben die kleinste offene Teilmengen. Das ist die nächste Definition. Definition 227 und eine entsprechende Definition wird Ihnen im Studium noch zigfach begegnen.
01:03:28
Methode der Höhenbildung. Also Sie haben irgendeine Teilmenge x ihres metrischen Raums. Nehmen Sie zum Beispiel die rationalen Zahlen in R, um ein krasses
01:03:41
Beispiel zu nehmen. Also M sind die realen Zahlen und x sind die rationalen. Das ist die kleinste abgeschlossene Menge, die die rationalen Zahlen enthält. Das definieren wir jetzt. Dazu brauchen wir alle abgeschlossenen Obermengen. Die Menge aller abgeschlossenen Obermengen bezeichnen wir mit Skript a, Index x. Also das sind alle Mengen a, die
01:04:06
x enthalten und die in M abgeschlossen sind. Und fürs andere brauchen wir die alle offenen Teilmengen. Also o, Index x sind alle Teilmengen von x, die offen
01:04:23
sind in M. So, damit können wir jetzt, was können wir jetzt definieren? Wir können definieren die größte offene Teilmenge von x, indem Sie sich alle Mengen o aus dem
01:04:41
o x hernehmen und die einfach alle vereinigen. Wenn Sie das machen, haben Sie eine große Vereinigung von offenen Mengen. Die ist offen. Jede Menge in dem o x ist eine offene Teilmenge von x und zwar die größte offene Teilmenge, weil eine größere ganz nicht geben,
01:05:00
weil die hätten Sie ja mit vereinigt. So, also und dieses Ding nennt sich das Innere von x, das was nicht am Rand ist. Das am Rand ist ja das, was das offen kaputt macht. Das schmeißt man weg, wenn man dieses Innere bildet. Das Innere von x und die übliche Notation dafür
01:05:24
ist x mit einem kleinen Kringel oben dran. Also das ist die größte offene Teilmenge von x. Die kann durchaus kleiner sein als x selber, also wenn Sie das halboffene Intervall von 0 bis 1 nehmen,
01:05:44
dann ist das Innere davon das offene Intervall von 0 bis 1. Das ist die größte offene Teilmenge, das ist noch offensichtlich. Das Beispiel von gerade eben, die rationalen Zahlen in R. Was ist da das Innere? Wer kennt eine offene Teilmenge der rationalen Zahlen? Ja, ich auch
01:06:00
nicht. Ja, die haben keine offene Teilmenge, weil die ja so staubig sind. Dementsprechend ist Q leer. Wenn Sie über die leere Menge vereinigen, kommt nicht viel raus. Das Innere von Q ist leer. Es ist eben staubig. Also man sieht, da kann ganz schön viel wegfallen.
01:06:23
Aber klar, es gibt keine offene Teilmenge von Q, also ist die größte offene eben Die kriegen wir wie? Wir nehmen alle abgeschlossenen Obermengen und schneiden die. Das ist eine
01:06:46
abgeschlossene Obermenge, weil erstens abgeschlossen als Schnitt von abgeschlossenen Mengen und zweitens eine Obermenge, weil jedes A aus A x ist eine Obermenge. Jede dieser Mengen A enthält x, also enthält auch der Schnitt x. Das ist die kleinste abgeschlossene Obermenge von x. Die nennt man den Abschluss von x und die wird üblicherweise
01:07:21
notiert als x mit einem großen Querstrich drüber. Der Querstrich ist damit mal wieder überladen. Aber ich meine, ich hoffe, niemand von Ihnen erwartet diesen Kapitel, dass ich hier meine, das konjugiert Komplexe von der Menge. Also Menge mit einem Strich drüber heißt Abschluss, heißt kleinste abgeschlossene Obermenge von dem Ding.
01:07:42
Nehmen wir die beiden Beispiele von gerade eben, das halboffene Intervall von 0 bis 1. Was passiert, wenn Sie das abschließen? Sie nehmen alle abgeschlossene Obermengen und machen den Schnitt. Da kommt die kleinste abgeschlossene Obermenge raus. Das ist das abgeschlossene Intervall von 0 bis 1. Keine Überraschung. Was passiert bei Q? Diesmal haben wir ein bisschen mehr Glück. Es gibt abgeschlossene Obermengen von Q. Nämlich
01:08:04
die ganz R. Fertig immer noch eine andere ein. Ein, warum? Was muss denn in so eine abgeschlossene Obermenge von Q drin liegen? Na ja, alle möglichen Grenzwerte von Folgen in Q müssen da schon drin liegen. Eine abgeschlossene Menge muss ja alle Grenzwerte
01:08:24
enthalten. Welche reellen Zahlen kann man durch rationale annähern? Alle. Also die einzige abgeschlossene Obermenge von Q ist R. Jetzt schneiden wir dieses R mit R. Dann kommt R raus. Also der Abschluss von rationalen Zahlen ist ganz R. Dass die so staubig sind,
01:08:43
ist dadurch ausgedrückt, dass das Innere leer ist. Dass der Abschluss alles ist, bedeutet, nennt man auch die rationalen Zahlen nicht. Die liegen eben überall. So, da ist eine Frage. Okay, die Frage ist klar. C ist auch eine abgeschlossene
01:09:00
Obermenge von Q. Da ist die Frage, was ist ihr zugrundelingender metrischer Raum? Der zugrundelingend metrischer Raum im Moment war R. Wenn Sie natürlich Q in C angucken, dann ist der Abschluss nicht ganz C, sondern R. Also wenn Sie nur das Q in R nehmen und das in C abschließen, kriegen Sie R. Das als Beispiel dafür, dass bei diesem inneren Bilden und
01:09:30
Abschlussnehmen durchaus was passieren kann, muss ja auch. Aber es ist sozusagen in gewisser Weise die minimale Manipulation, die Sie vornehmen müssen, um Ihre Menge abgeschlossen
01:09:41
zu machen oder Ihre Menge offen zu machen. Das ist das, was das Innere und der Abschluss in gewisser Weise das Zeug, was am Rand der Menge liegt. Und so definieren wir uns jetzt den Rand. Der Rand ist all das, was zum Abschluss gehört, aber nicht zum Inneren. Alle die
01:10:06
Punkte, die nicht kuschelig drin liegen, die aber beim Abschluss dazukommen. Im Rand liegen ja durchaus Punkte drin, die nicht zur Menge gehören und es liegen welche drin, die dazugehören. Und auf die Weise kann man sich wunderbar den Rand definieren. Der
01:10:26
die Punkte, die zum Abschluss gehören, aber nicht zum Inneren. Und die übliche Notation für den Rand ist so ein komisches Dx. Achtung, der Rand einer Menge kann sehr groß sein. Nehmen Sie das Beispiel von gerade eben. Nehmen wir erstmal das einfache
01:10:44
Beispiel, sei offen im Intervall von 0 bis 1. Was ist der Rand? Der Abschluss war das abgeschlossene Intervall. Das Innere war das offene Intervall. Der Rand ist 0 und 1. Das ist intuitiv schön. Randpunkte von dem Intervall 1 sind 0 und 1. Gut. Was ist der Rand von Q? Der Abschluss ohne das Innere, also R ohne Leer, gibt R. Der Rand
01:11:07
von Q ist R. Klar, weil jeder Punkt ist irgendwie im Abschluss drin, aber nie Also so ein Rand kann ganz schön groß sein. Rand ist viel. So, ich will noch einen zweiten
01:11:25
Blick auf Rand, Rand, Inneres und Abschluss werfen und dazu noch mal ein paar weitere Begriffe einführen, die wir zum Teil auch als erstes schon kennen, die wir jetzt hier hochziehen können auf metrische Räume. Und das erste ist der Begriff des Häufungspunkt.
01:11:46
Jetzt Häufungspunkt einer Menge. Was war der Häufungspunkt einer Menge? Ein Häufungspunkt einer Menge war einer, wir hatten das definiert, wir hatten es definiert als einen Punkt, den man aus der Menge heraus mit einer Folge approximieren kann.
01:12:06
Jetzt haben wir den Begriff der Folge noch nicht, aber man kann es trotzdem gut definieren über Umgebung und zwar folgender Maßen. Man nennt ein x0 aus M einen Häufungspunkt
01:12:29
von x, falls, egal welchen Radius epsilon größer 0 sie nehmen, wenn sie sich den
01:12:41
Teil von x anschauen, der näher als epsilon an x0 dran liegt, also den Schnitt von Umgebung von x0 mit x, dann muss diese Menge unendlich viele Elemente enthalten. Man muss es eben später eine Folge bauen können, die gegen diesen Punkt liegt. Also für
01:13:04
jedes epsilon in jeder noch so kleinen Kugel um x0 müssen unendlich viele Punkte der Menge liegen, dann nennt man es ein Häufungspunkt. So, zweiter Begriff der eines Randpunkts,
01:13:21
eine andere Definition von Randpunkt und dann zeigen wir hinterher, dass unsere beiden Begriffe, dass der Rand, genau die Menge der Randpunkte ist logischerweise, sonst wäre dann die Notation auch bescheuert. Also ich nenne ein x0 aus M einen Randpunkt von x. Hier könnte man sich noch überlegen, dass ein Punkt am Rand liegt. Jetzt mit
01:13:47
Umgebung, ein Punkt ist am Rand, wenn beliebig nah dran sowohl Menge als auch Nichtmenge liegt. Wenn ich eine Google drumrum finde, die gar nichts von der Menge enthält, dann ist er irgendwo weit weg. Oder wenn ich eine Google drumrum finde, die nur Menge
01:14:01
enthält, dann ist er vom Komplement weit weg. Aber ein Randpunkt ist einer, wo egal, wie nah dran irgendwie immer beides ist, Menge und Nichtmenge und das kann man schön mit Umgebung formulieren. Für jede Umgebung u von x0 ist sowohl u geschnitten mit der
01:14:24
Menge nicht leer, als auch u geschnitten mit dem Komplement der Menge nicht leer. Jede Umgebung von x enthält Menge und enthält Nichtmenge. Das ist der Begriff des Randpunkts.
01:14:40
Und dann schließe ich als drittes der Begriff des inneren Punktes, also x0 aus jetzt in dem Fall x ist ein innerer Punkt von x, wenn er wie schon mehrfach so genannt kuschelig drin liegt. Also wenn es ein Epsilon größer 0 gibt, sodass die Epsilonkugel um x0
01:15:05
ganz in x. Also wenn wir es uns mal nochmal wieder an unserem, was weiß ich,
01:15:23
an irgendeinem Intervall in R klar machen, wenn man abgestoßen Intervall in den halb offenen ist in R. Was ist ein Häufungspunkt davon? Jeder wo, also hier einer drin ist natürlich ein Häufungspunkt, egal welche Umgebung Sie drumrum legen. Da sind
01:15:41
nämlich viele Punkte der Menge drin. Die beiden Randpunkte sind auch Häufungspunkte, egal welche Umgebung Sie drumrum legen, sind immerhin nicht viel Menge. Ein Randpunkt ist einer, wo jede Umgebung Menge wie Nichtmenge enthält. Das klappt nur hier an den beiden Enden. Weil Sie an einem anderen Punkt sind, können Sie die Umgebung so klein machen, dass Sie entweder ganz in der Menge oder ganz im Komplement drin sind. Innerer
01:16:05
Punkt sind alle die, um die Sie eine kleine Umgebung finden, kleine Kugel finden, die noch ganz drin liegt. Das sind in dem Fall alle die, außer diesem Randpunkt links. Um den geht es ihm nicht. Wenn man sich diesen Begriff des inneren Punktes anschaut, sieht man, denke ich, sehr schnell, dass der direkte Beziehung zum Begriff
01:16:25
offen hat. Eine offene Menge ist eine, die nur aus inneren Punkten besteht. Wenn jeder Punkt innerer Punkt ist, dann haben Sie genau die Definition von offen. Und die anderen hängen mit den anderen Begriffen zu tun, haben mit den anderen Begriffen zu tun, die wir jetzt hatten. Und das will ich alles noch mal in einem Satz zusammenfassen. Also der
01:16:51
Satz 2.9. Wir haben irgendeine Teilmenge von M, den nenne ich wieder X. Dann gilt
01:17:04
erstens der Abschluss von X ist dasselbe wie X vereinigt mit seinem Rand, ist dasselbe wie das Innere von X vereinigt mit dem Rand. Zweitens, wie gerade schon gesagt, das Innere von der Menge können Sie gut beschreiben, sonst würden die Begriffe
01:17:24
auch nicht gut passen. Das sind die X in X, die innere Punkte sind. Drittens, den Rand
01:17:42
von X, auch das nur dann machen die Begriffe Sinn. Der Rand von X sind alle die Elemente von M, die Randpunkte sind. Und jetzt viertens noch eine Beschreibung für den Abschluss. Der Abschluss von X besteht erstmal aus X. Und was kommt beim Abschluss dazu?
01:18:06
Alle Häufungspunkte. Also der Abschluss von X ist X vereinigt mit der Menge aller Häufungspunkte von X. Das sind die Zusammenhänge an der Stelle. Woran liegt
01:18:30
das jeweils? So alles will ich nicht machen. Ich werde Ihnen A und D zeigen. B ist eigentlich relativ offensichtlich. Wenn ich einen inneren Punkt habe, dann
01:18:42
hört der zum Inneren, weil um diesen inneren Punkt gibt es so eine offene Menge, gibt so eine offene Umgebung. Die ist selbst eine offene Teilmenge von X. Also ist diese ganze, ist dieses X0 in der Vereinigung aller offenen Teilmengen drin, damit im
01:19:03
Inneren. Umgekehrt, wenn Sie den Punkt aus dem Inneren haben, dann gibt es eine offene Umgebung, so eine offene Kugel. Bisschen komplizierter ist D, deswegen will ich Ihnen das vorführen. A geht relativ fix, aber ist so schön, dass es mir nicht
01:19:24
entgehen lassen will. Wie zeigen wir A? Das Wesentliche, was wir für A brauchen, ist unsere Definition vom Rand. Die hoffentlich noch irgendwo steht. Da oben. Rand ist Abschluss ohne Inneres. Wir fangen links an. Der Abschluss von X, den können wir
01:19:45
erstmal zerlegen, in den Teil vom Abschluss, der im Inneren liegt, vereinigt mit dem Teil vom Abschluss, der nicht im Inneren liegt. Ich denke, mit der Gleichheit, die
01:20:07
können wir uns einigen. Ich nehme alles, den Teil, der im Inneren liegt und den Teil, der nicht im Inneren liegt und den nehme ich zusammen, dann habe ich das ganze So, dieses hintere Teil, oder nein, gucken wir uns erst das vordere an. Was ist der Abschluss
01:20:25
geschnitten, das Innere? Das Innere ist eine Teilmenge von X und der Abschluss ist eine Obermenge von X. So sieht die Lage aus. Wenn ich die beiden schneide, kommt also das Innere raus. Was ist der Abschluss ohne das Innere? Das ist genau daran, nach
01:20:47
Definition. Der Abschluss ist das Innere, vereinigt den Rand. Das links ist in dem
01:21:05
rechts enthalten. Jetzt mache ich diese ganze Angelegenheit zu einer größeren Menge, indem ich statt dem Inneren das ganze X nehme. Dann bin ich hier. Wenn
01:21:23
ich jetzt noch zeigen kann, dass das ganze wieder im Abschluss von X enthalten ist, bin ich fertig. Wenn jetzt noch Teilmenge X quer kommt, dann bin ich fertig, weil dann habe ich eine Ungleichungskette, wo links Abschluss steht und rechts der Abschluss, dann sind alle dazwischen gleich. Also zu tun noch, das ist Teilmenge von Abschluss von X.
01:21:44
Warum ist das eine Teilmenge vom Abschluss von X? Naja, wieder nach Definition vom Rand ist das X vereinigt mit dem Abschluss ohne das Innere. Jetzt machen wir das ganze noch mal
01:22:01
wieder ein bisschen größer, indem wir hier vorne statt X den Abschluss nehmen. X vereinigt mit dem Abschluss ohne das Innere. Der Abschluss vereinigt mit irgendeiner Teilmenge vom Abschluss. Naja, dann können Sie die Teilmenge vom Abschluss auch weglassen. Wenn Sie was mit einer
01:22:24
eigenen Teilmenge vereinigen, kommt da nicht mehr so wahnsinnig viel dazu. Also ist das Abschluss von X. Okay, und damit haben wir a, weil jetzt haben wir diese Inklusionskette, alle diese Mengen sind gleich und unterwegs tauchen alle die auf, die in a gefragt sind,
01:22:41
also sind die alle gleich. Dann wollte ich Ihnen noch d vorführen. Der Abschluss einer Menge ist die Menge vereinigt mit den Häufungspunkten. Mengengleichheit zu zeigen. Was tun wir? Wir zeigen zwei Inklusionen. Zunächst mal von links nach rechts. Also
01:23:02
der Abschluss ist enthalten da drin. Dazu nehmen wir uns ein X im Abschluss her. Dann gibt es einen ersten Fall, wenn das X in X ist, dann können wir reingehen, weil
01:23:21
dann ist es natürlich auch rechts. Spannend ist, wenn X nicht in X ist. Wenn X nicht in X ist, dann müssen wir ihm nachweisen, dass es ein Häufungspunkt ist. Also zweiter Fall. X nicht in X. Dann müssen wir, wenn wir wollen, dass es trotzdem rechts drin
01:23:42
ist, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass das X jetzt bitte schön ein Häufungspunkt ist. Also nehmen wir mal an, es ist keine. Also Annahme X, kein Häufungspunkt von unserer Menge Groß X. Was heißt das? Definition Häufungspunkt, haben wir hoffentlich
01:24:00
noch da oben. Häufungspunkt bedeutet, egal, welche kleine Kugel ich drum rumlege, der Schnitt dieser Kugel mit der Menge ist unendlich, hat unendlich viel Element. Also bedeutet kein Häufungspunkt. Legieren von Aussage. Kein Häufungspunkt bedeutet, es gibt
01:24:20
ein Epsilon größer Null, sodass dieser Schnitt nur endlich viel Element hat. Also kein Häufungspunkt. Dann gibt es ein Epsilon größer Null, sodass die Kugel um X mit Radius Epsilon geschnitten mit der Menge X, dass die endlich ist. Das
01:24:42
ist die Negation von Häufungspunkt. Was heißt das Ding ist endlich? Das Ding ist endlich heißt, ich nenne die Elemente mal, das sind irgendwelche Elemente X1, X2 bis Xr mit irgendeinem R aus N. Also es gibt eine Kugel um das X, sodass da drin nur
01:25:04
noch endlich viele Elemente von X liegen. Und das müssen wir jetzt auf Widerspruch führen dazu, dass unser X im Abschluss von X liegt. Dazu nehmen wir folgendes, wir definieren unseren Delta als das Minimum aller Abstände von X zu Xj,
01:25:28
wobei j von 1 bis r geht. Also wir nehmen alle diese Punkte in unserer Umgebung um X mit Radius Epsilon und bilden deren Abstand zu X. Dann behaupte ich, dieses Delta ist eine
01:25:44
strikt positive reelle Zahl. Und es ist nicht nur strikt positiv, sondern noch kleiner als Epsilon. Einfacher ist, warum ist es kleiner als Epsilon? Warum ist es kleiner als Epsilon? Naja, weil die Xj liegen alle in der Kugel um X mit Radius Epsilon, also ist
01:26:02
jeder Abstand von Xj zu X kleiner als Epsilon. Also das Minimum kleiner als Epsilon. Warum ist es strikt positiv? Weil jeder einzelne dieser Abstände strikt positiv ist, weil unser X nicht zu groß X gehört. Zweiter Fall. Unser X ist nicht in der Menge groß X. Unser X ist keins von diesen X1 bis Xr. Weil diese X1 bis Xr liegen alle in X. Das heißt, diese Abstände
01:26:28
von X zu Xj sind alle positiv und das Minimum von endlich vielen positiven Zahlen ist positiv. Also ist dieses Delta tatsächlich strikt zwischen Null und Epsilon. Also das Entscheidende hier ist X gehört nicht zu X. So, jetzt schauen sie sich aber mal die
01:26:48
Delta-Umgebung von X an. Also die Kugel um X mit Radius Delta. Und schneiden sie die mal mit X. Wie viele Elemente sind da drin? Muss man ganz genau zählen. Also erstmal können natürlich
01:27:06
nur die X1 bis Xr drin liegen, weil das U Delta ist eine Zeitmenge von dem Webseed. Aber die liegen alle auch nicht drin, weil deren Abstände sind ja gerade alle größer als Delta. Oder größer gleich als Delta. Aber da sind ja nur die drin, die kleiner als Delta-Abstände.
01:27:23
Da kann man ziemlich lang zählen, aber es kommt ziemlich null raus. Das ist eine leere Menge. Also diese Menge hier ist leer. Also was wir jetzt sozusagen uns mehrschrittig erarbeitet haben, ist wenn das X kein Häufungspunkt ist. Und das ist ein Schritt den man immer wieder braucht. Ich
01:27:45
werde das in Zukunft häufiger abkürzen. Aus dem Wissen X ist kein Häufungspunkt können Sie immer folgern. Es gibt eine Kugel um X, in der gar nichts von der Menge liegt. Aus ist kein Häufungspunkt folgt erstmal. Es gibt eine Kugel drumrum, in der nur endlich viele liegen. Aber mit diesem Trick kriegen Sie immer sofort. Es gibt da noch eine Kugel,
01:28:04
in der nichts mehr liegt. Also kein Häufungspunkt bedeutet, sie finden ein kleines Delta, sodass in der Kugel um X mit Radius Delta kein X mehr drin ist. Unser X hat nichts mit
01:28:21
Menge X zu tun. So und das sollte doch jetzt reichen, um zu zeigen, dass unser X auch nicht zum Abschluss gehört. Warum tut es das nicht? Schauen Sie sich mal das Kompliment von dieser Kugel mit Radius Delta an. Das Kompliment von dieser Kugel mit Radius Delta ist zunächst
01:28:42
mal eine abgeschlossene Menge, weil die Kugel U Delta X ist eine offene und der Das heißt, das X ist voll im Kompliment enthalten. Also dieses Ding ist eine Obermenge von X.
01:29:03
Das Kompliment ist eine Obermenge von X, weil die Kugel disjunkt zu X ist. So was haben wir also jetzt hier? Wir haben hier eine abgeschlossene Obermenge von X. Das U Delta von X Kompliment ist abgeschlossen. Wir wissen, also zunächst mal wissen wir,
01:29:27
unser X liegt nicht in diesem Kompliment. Das wäre der erste Mittelpunkt von einem Kreis, der im Kompliment von seinem eigenen Kreis liegt. U Delta von X liegt natürlich
01:29:41
in U Delta von X und damit nicht im Kompliment. So dieses Kompliment ist eine abgeschlossene Obermenge von X. Also das Ding hier ist in AX drin. Eine abgeschlossene Obermenge von X ist also insbesondere drin, enthält also insbesondere so enthält den Schnitt aller
01:30:08
abgeschlossenen Obermengen von X. Es ist schließlich eine davon. Wenn Sie jetzt noch mit anderen schneiden, wird das gar nicht größer, sondern nur klein. So das hier ist aber X Kompliment. Moment, hier steht nicht. X ist nicht im Kompliment von seiner
01:30:31
eigenen Kugel. Dieses Kompliment der eigenen Kugel ist eine Obermenge vom Abschluss, also ist X insbesondere auch nicht im Abschluss von X. Oder genauer gesagt, wenn man strikt
01:30:47
ist, haben wir hier einen Beweis durch Kontraposition gemacht. Wir haben gezeigt, wenn X kein Häufungspunkt ist, dann liegt es nicht im X. Umgekehrte Richtung. Das war nochmal
01:31:00
das gleiche Symbol. Also wir wollen zeigen, X vereint mit all seinen Häufungspunkten ist in Abschluss enthalten. 15, 10. Dann ist auch klar, warum alle so unruhig werden. Danke. Jetzt bin ich darauf 0 vorbereitet. Ja klar, 15, 10. So, also jetzt überlege
01:31:32
ich mir nach, ob ich die 5 Zeilen dann nächstes Mal noch am Anfang mache oder nicht. Gut, ja, bleibt mir nicht viel übrig als schönen Tag noch zu wünschen,
01:31:46
schönes Wochenende und mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Und dann bis Dienstag.
Recommendations
Series of 61 media