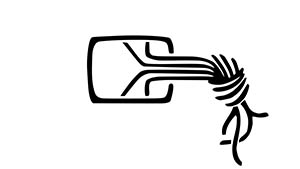Ein Auftrag an die Hochschulen: Berliner Appell für die Offene Wissenschaft im Gespräch mit denen, an die er sich richtet
This is a modal window.
Das Video konnte nicht geladen werden, da entweder ein Server- oder Netzwerkfehler auftrat oder das Format nicht unterstützt wird.
Formale Metadaten
| Titel |
| |
| Serientitel | ||
| Anzahl der Teile | 30 | |
| Autor | ||
| Lizenz | CC-Namensnennung 4.0 International: Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt zu jedem legalen Zweck nutzen, verändern und in unveränderter oder veränderter Form vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, sofern Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen. | |
| Identifikatoren | 10.5446/38672 (DOI) | |
| Herausgeber | ||
| Erscheinungsjahr | ||
| Sprache | ||
| Produzent |
Inhaltliche Metadaten
| Fachgebiet | ||
| Genre | ||
| Abstract |
|
2
17
00:00
GrundraumOffene MengeUnrundheitUmsetzung <Informatik>FreewareOffene MengeComputeranimation
01:29
KommunikationTelekommunikationModallogikProgrammierungBildschirmfensterEreignisdatenanalyseTotal <Mathematik>AggregatzustandDivergente ReiheMereologieWissensbasiertes SystemComputervirusStochastische AbhängigkeitProzess <Informatik>BRIEF <Programm>ProgramminspektionOffene MengeBaumechanikBeobachtungsstudieSoundverarbeitungOpen SourceMultiplikationsoperatorZweiKommunikationPhysikalische GrößeACCESS <Programm>Negative ZahlAPPELL <Programm>QuellcodeComputeranimation
05:22
TragfähigkeitBerechnungRechenbuchKurvenanpassungProzessfähigkeit <Qualitätsmanagement>Computeranimation
05:57
HardwareMengeSoftwareDatenverarbeitungssystemMereologieRuhmasseWort <Informatik>ART-NetzNeuroinformatikKurvenanpassungMultiplikationsoperatorSmartphoneComputeranimation
06:42
OrdnungsreduktionEbene KurveGRADEAutomatische HandlungsplanungVHDSLMinimalgradKurvenanpassungMultiplikationsoperatorUNIXComputeranimationDiagramm
07:22
GeschwindigkeitProgrammierungVerknüpfungsgliedErneuerungstheorieVollständigkeitBeobachtungsstudieEndliche ModelltheorieRechenbuchTor <Netzwerk>Computeranimation
08:26
ProgrammierungOrientierung <Mathematik>Projektive EbeneÄhnlichkeitsgeometrieProzess <Informatik>Offene MengeAuswahlverfahrenVollständiger VerbandTrennschärfe <Statistik>AuswahlverfahrenComputeranimationVorlesung/Konferenz
09:18
Natürliche ZahlProgrammierungGebäude <Mathematik>Physikalische TheorieProgrammbausteinVerschlingungPunktspektrumDifferentep-BlockProgrammbausteinHöheOffene MengeUmsetzung <Informatik>Computeranimation
10:04
SoftwareUniformer RaumGrundraumPhysikalische TheorieOffene MengeAPPELL <Programm>Computeranimation
10:22
Einfach zusammenhängender RaumOffene MengeAPPELL <Programm>MultiplikationsoperatorOffene MengeAPPELL <Programm>Computeranimation
11:52
APPELL <Programm>Computeranimation
12:11
InformationProgrammierungVideokonferenzResonatorResonanzChipkarteGrundraumVerschlingungFlächeninhaltGüte der AnpassungComputervirusAbstandProzess <Informatik>PunktOffene MengeArithmetische FolgeAPPELL <Programm>AuswahlverfahrenSoundverarbeitungTrennschärfe <Statistik>HauptidealDatenparallelitätOrtsoperatorEinsMenütechnikFormation <Mathematik>APPELL <Programm>Vorlesung/Konferenz
15:24
EditorInformationSelbst organisierendes SystemStabDigitalisierungImpulsComputersimulationGrundraumLeistungsbewertungMaßerweiterungMomentenproblemResultanteZahlenbereichExogene VariableTexteditorProzess <Informatik>PunktRepository <Informatik>Offene MengeAntwortfunktionUnrundheitWeb-SeiteBeobachtungsstudieMailing-ListeSoundverarbeitungAutorisierungMultiplikationsoperatorRohdatenUmfangTwitter <Softwareplattform>Fakultät <Mathematik>Offene MengeAPPELL <Programm>Vorlesung/Konferenz
19:24
Vorlesung/Konferenz
Transkript: Deutsch(automatisch erzeugt)
00:06
Jetzt kommt Georg Hagedorn. Bei manchen steht noch eine Dame im Programm. Das ist allerdings falsch, weil sie heute leider krank ist. Georg kommt vom Naturkundemuseum Berlin, ist aber jetzt eigentlich hier im Auftrag der Wikimedia,
00:29
für die er sich auch engagiert, und wird uns jetzt ungefähr 20 bis 30 Minuten einen Talk halten. Ein Auftrag an die Hochschulen, Berliner Appell für eine offene Wissenschaft im Gespräch mit
00:41
denen, an die es sich richtet. Einen großen Applaus, bitte. Jetzt, gut. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr da seid.
01:06
Ich erzähle heute was von einem Fellow-Programm, freies Wissen, Wissenschaft offen gestalten, das Wikimedia zusammen mit dem Stifterverband im zweiten Jahr jetzt durchführt. Ich erzähle überwiegend vom ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind wir gerade in der Auswahlphase.
01:22
Aber wir planen das weiterzuführen. Insofern ist es sicherlich interessant, auch das weiterzugeben, was da passiert. Ich biete euch drei Nüsse an. Open Science, Fellow-Programm und der Berliner Appell. Was ist der Berliner Appell? Erst mal Open Science. Open ist hier in aller Munde. Und Open Science ist erst mal Wissenschaft,
01:44
welche alle analysierten und produzierten Daten als Open Data und Methoden als Open Source transparent zur Verfügung stellt, Erkenntnisse unter Open Access publiziert bzw. in Open Knowledge-Systeme einarbeitet und in der Lehre Open Educational Resources einsetzt.
02:02
Besonders wichtig ist dabei, es gibt ja einen Wissenschaftsprozess. Es gibt nicht nur Produkte, Rohprodukte, sondern es gibt einen Prozess. Und vielleicht das Spannendste und das Eigenständigste an Open Science ist genau, wie kann dieser Prozess, dieses Erforschen, dieses Diskurs, was ist richtig, was ist Wahrheit, was weiß ich, was weißt du, besser und offener gemacht werden.
02:24
Bei all dem stellt sich aber die Frage nach dieser Reihung von lauter Openness-Sachen, ob das jetzt abklatsch oder Notwendigkeit ist. Ich glaube natürlich Notwendigkeit. Also erst mal Open Science kann produktiv sein. Open Science hat es schon geschafft, Sachen zu lösen, die vorher in dieser Zeit nicht zu schaffen wären.
02:44
Ein Beispiel sind zum Beispiel die Virusforschung um den Zizka-Virus, der gerade frisch aufgekommen ist. Kommunikation und globale Zusammenarbeit war immer Teil von Wissenschaften.
03:00
Menschenwissenschaftlerinnen haben zusammen gearbeitet vor 200 Jahren. Wissenschaftlerinnen haben mit der Bevölkerung zusammen gearbeitet in bürgerwissenschaftlichen Zusammenarbeiten. Nur damals lief das halt mit Briefen und Postkarten und heute ist einfach mehr drin. Und dieses mehr drin, das wollen wir nutzen. Da gibt es aber gewisse strukturelle Probleme, die man sich so eingesetzt hat,
03:26
eingeritzt hat, die es schwer machen, die bestimmte Sachen schwer machen. Das zweite Beispiel ist Wissenschaft kann Qualitätsprobleme haben. Ein Beispiel hier möchte ich anführen, das bekannte Tamiflu. Ihr habt vielleicht noch in Erinnerung, in 2009 hatte die Welt Angst vor einer Grippeepidemie mit dem Vogelgrippevirus H1N1.
03:48
Und ich möchte hier betonen, dass alle Kritik zu Tamiflu sollte nicht zur Nachlässigkeit gegenüber solchen Grippeepidemien führen. Das ist wirklich so eine Grippeepidemie, kann wirklich eine ganz, ganz große, ganz gefährliche, ganz tödliche Sache sein.
04:03
Insofern haben die Leute damals, die dann beschlossen haben, Tamiflu für allein den US und UK für zwei Milliarden US-Dollar einzulagern, nicht fahrlässig gehandelt, sondern eigentlich sehr verantwortlich. Das Problem ist bloß, Tamiflu ist eigentlich nicht besonders wirksam, wenn es überhaupt wirksam ist.
04:21
Und das wusste man in 2009 noch nicht. Es gibt sogenannte Cochrane-Reviews und die Cochrane-Review von Tamiflu war positiv. Man hat sich halt an die üblichen Publikationen, die im üblichen Zulassungsverfahren notwendig waren, gehalten. Dann kamen erste kritische Stimmen auf und man hat versucht zu schauen, ja was ist denn, und hat festgestellt, niemand.
04:42
Die Zulassungsbehörden nicht, die WHO nicht, niemand hat die Daten eigentlich hinter diesen Studien. Und als man die Daten dann tatsächlich hatte, gab es ein Review von Cochrane 2014 mit einem negativen Ausgang. Das Zeug wirkt nicht gut und hat erhebliche Nebenwirkungen. Geld zum Fenster rausgeschmissen.
05:01
Schlimmer noch wäre es, wenn wir tatsächlich so eine Epidemie hätten und wir hätten Millionen, wenn nicht Milliarden Tote. Aber das ist ein Einzelbeispiel. Es gibt mehr Beispiele. Wir haben gerade ein Virus gehabt, wir haben das Tamiflu gehabt. Ich glaube, der ganze Zustand der Welt ist so, dass große Teile unserer Wissenschaft nicht nett, sondern notwendig und in gewisser Weise überlebensnotwendig sind.
05:23
Das ist eine Bevölkerungskurve. Wir sind gerade bei 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Und das ist nach allem, was wir wissen, entweder an der Grenze oder schon jenseits der Grenze der Tragfähigkeit unseres Planeten. Die Berechnungen sind vom Earth Overshoot Day.
05:40
Das war jetzt der 2. August. Das heißt, wir leben jetzt knapp einen Monat auf Kosten unserer Kinder. Wir verbrauchen das Zeug, was nicht uns gehört, sondern was unsere Kinder eigentlich haben müssten. Wir leben, als ob wir mehrere Planeten hätten, als ob wir 1,7 Planeten hätten. Das kann nicht gut gehen. Das wissen wir eigentlich alle. Symptome sind dann CO2 und Klima, gerade HW in aller Munde.
06:02
Zu Recht Artensterben, Bodenverlust, Nahrung. Wie werden wir die Menschen erlähren? Das hat ganz viel mit Population zu tun. Das hat ganz viel mit Menschen, wie viele Menschen auf der Erde leben wollen, leben und auch gut leben sollen natürlich zu tun. Hier in der Kurve, schaut euch mal an, dieses mittlere Teil, was da rechts so explodiert, die rote Kurve, das ist übrigens China.
06:26
Das passt hier zur Netzpolitik, weil das ist natürlich die ganze Hardware, die wir ständig verwenden von Computern und Smartphones. Die produziert da die entsprechende Menge CO2. Und das, wie man sieht, seit 2000 in gigantisch erhöhtem Maße.
06:44
Und aus diesen ganzen Problemen folgt eins. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Wir fahren somit Hochgeschwindigkeit gegen eine Mauer. Das heißt nicht, dass wir das nicht abwenden könnten, aber wir müssen handeln. Wir müssen schnell sein. Hier ist eine Kurve, die sagt, wenn wir tatsächlich dieses 2 Grad Klimaziel erreichen wollen, wie schnell wir eigentlich handeln müssen.
07:04
Wir sind jetzt im Jahr 2017 und wir müssten jetzt schon deutlich, viel deutlicher als wir es tun, bergab gehen. Wir müssten vor allen Dingen die Pläne fix haben, wie wir tatsächlich auf fast 0 CO2 Reduktion bis zum Jahr 2030 bis 40 gekommen sind.
07:20
Das haben wir nicht. Es gibt Wissenschaft, die sich damit beschäftigt. Zum Beispiel die Frage nicht, wie wir 3 Prozent mehr Windenergie in Deutschland oder in anderen Ländern bekommen, sondern wie wir tatsächlich die gesamte Welt auf 100 Prozent Erneuerbare umstellen können. Das wird aber relativ konventionell betrieben. Also hier ist so eine Studie von Jakobsen ganz neu 2017.
07:42
Er macht das schon seit 10 Jahren und seit 10 Jahren tobt ein wissenschaftlicher Kampf von Darstellungen, von Plänen, von Analysen, von Gegenanalysen, von Widersprüchen. Und keiner hat eigentlich alle Daten, keiner kennt die kompletten Modelle, die jemand rechnet. Auch in Deutschland gibt es eine Superstudie vom Fraunhofer Institut.
08:03
Kann man aber nicht nachvollziehen, kann man nicht wirklich kritisieren, kann man nicht wirklich sagen, ja, da habt ihr recht. Aber hier müsste man was anderes machen, weil das ist halt ein Riesenmodell, was hinter den Toren von Fraunhofer verschlossen ist. Also wir versuchen Dinge, die eigentlich sehr dringend sind, mit Closed Signs zu lösen und wir schaffen da nicht die Geschwindigkeit.
08:24
In dem Fellow-Programm sagen wir, wenn sich Forschung und Lehre öffnen, wird Zukunftsorientierung und Qualität von Wissenschaft gestärkt und die Gesellschaft kann besser am dort entstehenden Wissen teilhaben. Daraufhin hat Wikimedia ein Fellowship-Programm zusammen mit den Partnern vom Stifterverband und jetzt neu der Volkswagen Stiftung aufgelegt.
08:48
Dort werden junge Wissenschaftlerinnen unterstützt, ihre Arbeit offener zu gestalten. Die Fellows reichen Projekte ein, die begutachtet werden. Es gibt ein Auswahlverfahren. Wenn man durch das Auswahlverfahren durch ist, gibt es 5000 Euro Zuschuss, gemeinsame Treffen, Mentoring, Vernetzungstreffen und ähnliches.
09:07
Wir wollen dort die Prinzipien offener wissenschaftlicher Praxis mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen testen und sie gleichzeitig in die Institutionen verstärkt einbringen. Die Programmbausteine sind Qualifizierung, Sichtbarkeit, finanzielle Unterstützung und Mentoring.
09:27
Ich übergehe das jetzt mal, später wird die Folie noch gezeigt. Das sind unsere Fellows aus dem letzten Jahr. Tolle Leute mit fantastischen Ideen, mit einem ganz breiten Spektrum von theoretischem Vorwissen,
09:43
von verschiedenen Ansätzen, von verschiedenen wissenschaftlichen Hintergründen, Geistes, Kultur, Medien, Rechts, Naturwissenschaften, alles dabei. Wer dann später von dem Link folgen kann, kann sich anschauen, was dort erreicht wurde.
10:05
So, diese jungen Menschen stehen jetzt viel weniger als wir vielleicht so in der Theorie von Open Science und viel mehr in der Praxis ihrer Institutionen. Was ist möglich? Was darf ich denn? Darf ich überhaupt Software publizieren? Das verbietet mir hier meine Uni eigentlich.
10:21
Und daraus abgehend, sie knacken jetzt praktisch sozusagen die Nüsse mit viel Begeisterung, aber sie sind jetzt mit ihren Institutionen konfrontiert und sollen dort dran arbeiten, dass dort die Nüsse etwas offener werden. Und diese Fellows haben daraufhin dann einen Berliner Appell für eine offene Wissenschaft formuliert.
10:40
Der bezieht sich jetzt nicht auf alles Mögliche von Open Science, sondern ganz konkret auf Open Science in deutschen Institutionen. Und sie sagen, es ist wichtig, dass die Institutionen eine Policy haben, dass sie sich klar zur offenen Wissenschaft bekennen und das auch ausformulieren. Und die Grundsätze mit Verbindlichkeit ausformulieren. Es muss Ansprechpartner geben.
11:04
Es muss jemanden geben, wo man fragen kann, sag mal, wie verstehe ich das denn hier? Mein Professor, meine Professorin sagt mir X, ich höre gleichzeitig Y. Wie gehe ich damit um? Die Personalpolitik ist zu fördern. Das heißt, offene Wissenschaft findet nur dann statt, wenn sie auch wichtig ist,
11:26
wenn sie auf Ausschreibungen, Kriterienlisten, auf Zielvereinbarungen formuliert wird. Wenn es um Lehre geht, gibt es eindeutig einen Mehraufwand, wenn ich Open Educational Resources mache, statt mir die Sachen zusammenzuklauen. Und das soll honoriert werden.
11:43
Und gleichzeitig eben auch die Honorierung in der Forschung, zum Beispiel durch geeignete Preise, die speziell auf offene Wissenschaft abzielen. Mein Ampel an Sie. Soweit Sie da betroffen sind, tragen Sie solche Diskussionen in Ihre Institutionen rein.
12:02
Sprechen Sie mit Leuten, die das angeht. Vielleicht sind Sie nicht selbst betroffen. Vielleicht können Sie das weiter tragen. Hier nochmal die Übersicht. Erstmal möchten wir nochmal danken den Förderern, dem Stifterverband der Volkswagen Stiftung und Wikimedia. Und wir haben hier einen Kurzlink für den Appell für offene Wissenschaft, falls Sie das nachlesen wollen.
12:26
Weitere Informationen. Wie gesagt, das Auswahlverfahren für dieses Jahr läuft gerade. Die Einreichungen sind abgeschlossen, aber es ist geplant, das nächste Jahr zu wiederholen. Also geben Sie es vielleicht weiter an Leute, die interessiert sein könnten. Und es gibt Videos zu dem Programm.
12:43
Herzlichen Dank. Hat jemand noch Fragen dazu? Das wollte ich auch gerade fragen. Könnte alle das Mikro haben?
13:03
Hallo. Vielen Dank erst mal. Ich wundere mich jetzt vor allem nach den Endausführungen, ob es da schon eine Resonanz gegeben hat, wie die Institutionen direkt darauf reagieren, dass Forschung veröffentlicht werden soll. Ob es da großen Widerstand gibt oder ob das eher etwas ist, was auch auf Zuspruch trifft.
13:22
Also es trifft durchaus auf Zuspruch, gerade die Frage von Open Access. Das kommt auf die Disziplinen sicherlich an. Es gibt Disziplinen, die sind da etwas weiter entfernt. Und andere, die sind schon sehr nah dran zu sagen, eigentlich macht alles außer Open Access keinen Sinn. Es gibt viele Vorbehalte davon, den Wissenschaftsprozess offen zu gestalten, also sich sozusagen in die Karten blicken zu lassen.
13:47
Vielleicht, dass die Konkurrenz etwas erfährt, was sie besser nicht erfahren sollte und die publizieren nachher schneller. Das sind große Ängste in vielen Bereichen. Von den Institutionen sozusagen, die Fellows haben unmittelbar mit ihren Institutionen gesprochen, dort auch positive Resonanz bekommen.
14:07
Aber jetzt Wikimedia hat es zum Beispiel nicht geschafft, das war ja im Programm anders angekündigt, hier jemanden von der Hochschulrektorenkonferenz einzuladen, sodass wir miteinander diskutieren könnten. Also da gibt es eine gewisse Distanz oder vielleicht auch Unsicherheit einfach, dass man mit den eigenen Konzepten noch nicht so weit ist.
14:28
Und ich glaube, das kann durchaus auch eine der Hauptwirkungen dieses Appells sein. Ich denke, es ist gut, wenn er bekannt wird, es ist gut, wenn er weitergetragen wird, wenn er eine gewisse Resonanz hat.
14:41
Die Universitäten werden nicht scharenweise hinterherrennen und sagen, ja genau so muss es sein. Aber sie werden zunehmend gedrängt sein, eigene Positionen zu verfassen. Und das ist ja genau das, was der Berliner Appell fordert.
15:05
Hallo, ich wollte fragen, diese Punkte des Berliner Appells, welche davon ist aus Ihrer Sicht, oder welche sind einfacher umzusetzen und welche sind schwieriger umzusetzen und warum? Also was sind die größeren Hürden und was sind die kleineren in dieser Aufzählung?
15:29
Ich denke, die Punkte vier und fünf sind, da sie sehr flexibel sind und nicht gesagt wird, in welchem Umfang das machen, sind sie gut und schnell umzusetzen. Sie erfordern keine Abstimmung der gesamten Universität.
15:43
Man kann das als Impuls geben. Das geht gut. Die Förderung der Personalpolitik ist aus meiner Sicht schon, dass ich es wirklich auf die Kriterienliste von allen Berufungen schreibe, erfordert eigentlich den Punkt eins, dass die Wissenschaftseinrichtungen klare Policies haben, klare Richtlinien,
16:04
sich darüber im Klaren sind, dass sie das umfänglich und in welcher Form fördern wollen. Der Punkt zwei wiederum, eine personelle Verankerung, zumindest in der Zeit, eine Zuweisung, eine Sichtbarmachung, eine Verantwortung dafür, das ist relativ leicht zu erledigen.
16:21
Ich denke, die Punkte eins und drei sind die großen Punkte. Die anderen sind Punkte, wo man Initiative zeigen kann, wo man sehr schön etwas bewirken kann. Ich halte das auch für sehr wertvoll, wenn man da aktiv wird. Aber das große Dickebrecht ist sicherlich eine Formulierung der Grundsätze zur offenen Wissenschaftsmethodik, die ein längerer Prozess sein wird.
16:57
Vielen Dank. Keine Frage. Eine kurze Anmerkung. Ich glaube, was richtig helfen würde, ist, mit den akademischen Societies,
17:06
Konferenzveranstaltern und so intensiver darüber zu sprechen. Zum Beispiel in meiner Community, in Data Networking, geht es oftmals als Phänomen, dass Ergebnisse publiziert werden, die auf irgendwelchen Situationen beruht, die keiner nachvollziehen kann.
17:22
Da ist es einfach im Interesse der Erhöhung der Qualität der Erforschung unumgänglich, dass man diese Daten oder Dimensionsprogramme zum Beispiel offenlegt. Da sehen wir einen deutlichen Trend, dass das mehr und mehr passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Themengebieten durchaus ähnlich ist.
17:45
Es wird einfach zu viel unüberprüfbar publiziert. Da könnte man sie gut ansetzen. Genau die Frage, was kann ich nachvollziehen? Das ist in verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich.
18:03
Es gibt Disziplinen, bei denen es wirklich reicht, ganz klar die Rohdaten in ein Datenrepositorium zu legen. In anderen Fällen reicht auch das nicht. Auch in den medizinischen Studien, die ich angesprochen habe, wenn ich da nur die Zahlen hinterlege und nicht sage, wie sind denn jetzt die verschiedenen Auswertungen vorher definiert gewesen.
18:21
Das sind so typische Knackpunkte. Was heißt denn jetzt, dass X eingetreten ist? Wie ist das festgestellt worden? Ist das Pi mal Daumen? Oder ist dort tatsächlich eine Methodik hinter und welche? All diese Sachen werden häufig in Publikationen nicht ausreichend in der gewünschten Knappheit beschrieben. Ich finde das übrigens auch ganz spannend.
18:41
Ich denke, das ist auch übrigens ein Nebeneffekt von Open Access Publikation. In dem Moment, wo wir auf das Papier verzichten können, können wir auch manchmal etwas wieder in Publikation schreiben, was uns zurzeit ständig rausgekürzt wird. Wo die Autoren sagen, das brauche ich eigentlich, das muss ich meinen Kollegen mitteilen. Und auch aus eigener Erfahrung.
19:00
Die Editoren sagen dann, kürzen Sie bitte um vier Seiten, das ist uns zu lang. Das ist eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß im Zeitalter des digitalen Publizierens. Weitere Fragen? Dann schließen wir den Talk hier.
19:20
Vielen Dank, einen Applaus bitte.
Empfehlungen
Serie mit 16 Medien