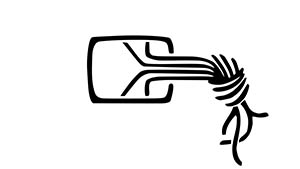Nach einer kurzenmedientheoretischen Einführung und Hinführung zum Kulturellen Gedächtnis Digital wird aufgezeigt, mit welch schwierigen Problemstellungen die Kulturerbeeinrichtungen bei der Überlieferung des Kulturerbes in digitaler Form (Digitalisierung & Zurverfügungstellung der Abbilder ggfs. noch geschützter körperlicher Werke) sowie des neuen digitalen Kulturerbes (Gifs, Memes, Remixes, Mashups etc.) konfrontiert sind.
Für die Organisation des digitalen und digitalisierten Kulturerbes kommt dem Urheberrecht eine entscheidende Bedeutung zu. Der Grund dafür liegt im Charakter des Urheberrechts als Ausschließlichkeitsrecht. Auf dessen Grundlage steht es den jeweiligen Rechteinhabern – Urhebern, Verlegern, Tonträgerherstellern, Filmproduzenten und Datenbankherstellern – frei, darüber zu entscheiden, ob und wer ihre Werke digital speichern, vervielfältigen und zugänglich machen darf. Damit rücken marktwirtschaftliche Privatinteressen in den Vordergrund. Das Allgemeininteresse an Erhaltung und Zugänglichkeit des kulturellen Erbes kann dagegen nur im Wege gesetzlicher Ausnahmebestimmungen Berücksichtigung finden, denen jedoch durch das internationale Recht wie durch die Verfassung vergleichsweise enge Grenzen gesetzt sind.
Das hat insbesondere im Hinblick auf die proprietäre Praxis der Museen in Bezug auf Reprografien negative Auswirkungen auf den freien Zugang zum digitalen Gedächtnis und die freie Nutzbarkeit unserer eigentlich gemeinfreien Schätze, wie an Beispielen aufgezeigt wird. |