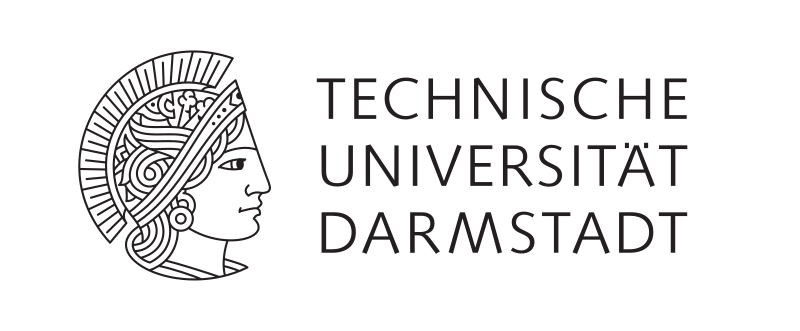Die Greensche Funktion
This is a modal window.
Das Video konnte nicht geladen werden, da entweder ein Server- oder Netzwerkfehler auftrat oder das Format nicht unterstützt wird.
Formale Metadaten
| Titel |
| |
| Serientitel | ||
| Teil | 10 | |
| Anzahl der Teile | 14 | |
| Autor | ||
| Lizenz | CC-Namensnennung - keine kommerzielle Nutzung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland: Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt zu jedem legalen und nicht-kommerziellen Zweck nutzen, verändern und in unveränderter oder veränderter Form vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, sofern Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen und das Werk bzw. diesen Inhalt auch in veränderter Form nur unter den Bedingungen dieser Lizenz weitergeben. | |
| Identifikatoren | 10.5446/31323 (DOI) | |
| Herausgeber | ||
| Erscheinungsjahr | ||
| Sprache |
Inhaltliche Metadaten
| Fachgebiet | ||
| Genre | ||
| Abstract |
|
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
00:00
Finite-Elemente-MethodeMathematikNumerische MathematikRechnenRelativitätstheorieWärmeleitungFunktion <Mathematik>MengenlehreKategorie <Mathematik>IntegralUnendlichkeitAbbildung <Physik>EindeutigkeitFunktionalGrundlösungKompakter RaumMomentenproblemResultanteTermLinearisierungKonstanteNichtlineares GleichungssystemReelle ZahlDeltafunktionAbleitung <Topologie>Stetig differenzierbare FunktionDiffusionsprozessDistributionenraumPunktProzess <Physik>Arithmetischer AusdruckPartielle DifferentiationKompakter Träger <Mathematik>Objekt <Kategorie>Randbedingung <Mathematik>RandwertDifferenz <Mathematik>Freier LadungsträgerMinkowski-MetrikVorlesung/Konferenz
05:58
DifferentialgleichungDifferentialoperatorQuadratIntegralAusdruck <Logik>Hyperbolischer DifferentialoperatorFundamentalsatz der AlgebraFunktionalGreen-FunktionGrundlösungMereologieMomentenproblemPartieller DifferentialoperatorNichtlineares GleichungssystemAbleitung <Topologie>DistributionenraumMultifunktionJensen-MaßKonditionszahlRandintegralSupremum <Mathematik>Element <Gruppentheorie>MultiplikationsoperatorZweiVorlesung/Konferenz
11:47
SymmetrieTrägerAusdruck <Logik>UnendlichkeitFunktionalGrundlösungIndexberechnungDeltafunktionAbleitung <Topologie>PunktBetrag <Mathematik>DifferenzkernVerschränkter ZustandKompakter Träger <Mathematik>Freier LadungsträgerRechter WinkelVorlesung/Konferenz
15:39
TrägerVariableIntegralAusdruck <Logik>EbeneFunktionalGrundlösungKompakter RaumKonstanteDeltafunktionDistributionenraumPunktElement <Gruppentheorie>Freier LadungsträgerVorlesung/Konferenz
17:40
ValiditätMengenlehreZahlensystemVariableAusdruck <Logik>Aussage <Mathematik>GrundlösungLeistung <Physik>ResultanteDeltafunktionAbleitung <Topologie>DistributionenraumNegative ZahlArithmetischer AusdruckElement <Gruppentheorie>Vorlesung/Konferenz
20:35
Singularität <Mathematik>IntegralAusdruck <Logik>Derivation <Algebra>Gebiet <Mathematik>GrundlösungTermRegulärer GraphDeltafunktionAbleitung <Topologie>DistributionenraumArithmetischer AusdruckVorlesung/KonferenzTafelbild
22:06
AnalysisMathematikNatürliche ZahlNumerische MathematikFunktion <Mathematik>MengenlehreWürfelBeschränktes GebietTemperaturverteilungQuadratVektorraumIntegralHyperbolischer DifferentialoperatorBeweistheorieFunktionalGebiet <Mathematik>Green-FunktionGrundlösungKoordinatenPartielle IntegrationPhysikalisches SystemPoisson-GleichungTermFlächeninhaltKonstanteNichtlineares GleichungssystemReelle ZahlVektorEckeLängeDistributionenraumQuadratzahlExistenzsatzBetrag <Mathematik>Klasse <Mathematik>Fortsetzung <Mathematik>Partielle DifferentiationElement <Gruppentheorie>Minkowski-MetrikVorlesung/Konferenz
29:19
KurveFunktion <Mathematik>WürfelZahlensystemVektorraumGanze FunktionAlgebraisch abgeschlossener KörperEinfach zusammenhängender RaumFunktionalGebiet <Mathematik>GlättungGlatte FunktionKoordinatenMereologiePhysikalisches SystemResultanteFlächeninhaltVektorKanteEckeLängeZusammenhängender GraphGammafunktionQuadratzahlExistenzsatzPunktGlattheit <Mathematik>QuaderRandInklusion <Mathematik>KonditionszahlTupelMinkowski-MetrikGruppendarstellungVorlesung/Konferenz
35:30
KurveMathematikVerschiebungsoperatorQuadratFlächeGanze FunktionAusdruck <Logik>KnickenAnalogieschlussDifferentialFunktionalGlatte FunktionIndexIndexberechnungKoordinatenPhysikalisches SystemStetige FunktionViereckFlächeninhaltGegenbeispielKanteEckeStetig differenzierbare FunktionQuadratzahlPunktGlattheit <Mathematik>Körper <Algebra>Offene MengeRandMultifunktionKonditionszahlVorlesung/Konferenz
41:29
WärmeleitungIntegraldarstellungAusdruck <Logik>Hyperbolischer DifferentialoperatorFunktionalGebiet <Mathematik>GeradeGrundlösungIdeal <Mathematik>Lemma <Logik>TermFlächeninhaltAbleitung <Topologie>GammafunktionPunktKartesische KoordinatenKonditionszahlElement <Gruppentheorie>MultiplikationsoperatorRandwertGruppendarstellungVorlesung/Konferenz
45:07
MathematikSingularität <Mathematik>IntegralAusdruck <Logik>Algebraisch abgeschlossener KörperBeweistheorieFunktionalGarbentheorieGebiet <Mathematik>GrenzwertberechnungGrundlösungInverser LimesLemma <Logik>MomentenproblemPhysikalische TheorieFlächeninhaltVektorÄhnlichkeitsgeometrieNormalvektorGammafunktionQuadratzahlPunktBetrag <Mathematik>VerallgemeinerungInnerer PunktRadiusRandintegralNormaleMultiplikationsoperatorMinkowski-MetrikStrukturgleichungsmodellVorlesung/Konferenz
49:53
Singularität <Mathematik>GrenzwertberechnungGrundlösungGammafunktionVorlesung/Konferenz
51:35
Singularität <Mathematik>UnendlichkeitBeweistheorieGrenzwertberechnungGrundlösungParametersystemAdditionPunktElement <Gruppentheorie>Algebraisches ModellVorlesung/Konferenz
53:41
VerschiebungsoperatorIntegralAusdruck <Logik>Arithmetisches MittelDifferentialGreen-FunktionGrenzwertberechnungGrundlösungLemma <Logik>Partielle IntegrationTeilmengeAbleitung <Topologie>QuadratzahlPartielle DifferentiationElement <Gruppentheorie>Vorlesung/Konferenz
55:06
IntegralAusdruck <Logik>Green-FunktionGrenzwertberechnungMereologieTermAbleitung <Topologie>GammafunktionQuadratzahlPoisson-KlammerInnerer PunktVorzeichen <Mathematik>RandintegralStandardabweichungZweiRechter WinkelVorlesung/Konferenz
58:39
Singularität <Mathematik>ZahlensystemIntegralAusdruck <Logik>Derivation <Algebra>UngleichungBeweistheorieGrenzwertberechnungGrundlösungKoordinatentransformationKugelMereologieSphäreTermKonstanteRuhmasseAbleitung <Topologie>GammafunktionBetrag <Mathematik>Arithmetischer AusdruckFlächentheorieRandintegralRichtungsableitungVorlesung/Konferenz
01:02:39
IntegralUnendlichkeitBeweistheorieGrenzwertberechnungMereologiePaarvergleichTermFlächeninhaltGebietsintegralVorlesung/Konferenz
01:04:01
Singularität <Mathematik>FunktionalGrenzwertberechnungGrundlösungResultanteTermFlächeninhaltKonstanteRadiusTafelbild
01:05:19
IntegraldarstellungKategorie <Mathematik>IntegralAusdruck <Logik>Hyperbolischer DifferentialoperatorBeweistheorieGrundlösungLemma <Logik>Ableitung <Topologie>NormalvektorRandintegralRechenbuchRechter WinkelGruppendarstellungVorlesung/Konferenz
01:07:07
Dirichlet-ProblemAusdruck <Logik>FunktionalGrundlösungMereologieNichtlineares GleichungssystemAbleitung <Topologie>GammafunktionPunktDifferenzkernElement <Gruppentheorie>Auflösung <Mathematik>LESVorlesung/Konferenz
01:09:17
GleichungDirichlet-ProblemDifferentialErwartungswertFunktionalGrundlösungNichtlineares GleichungssystemParametersystemQuadratzahlElement <Gruppentheorie>Vorlesung/Konferenz
01:11:04
Funktion <Mathematik>Singularität <Mathematik>Dirichlet-ProblemKategorie <Mathematik>Algebraisch abgeschlossener KörperEinfach zusammenhängender RaumFunktionalGebiet <Mathematik>Glatte FunktionGrundlösungLemma <Logik>FlächeninhaltAuflösbare GruppeZusammenhängender GraphStetig differenzierbare FunktionGammafunktionQuadratzahlGlattheit <Mathematik>Innerer PunktExplosion <Stochastik>DifferenteVorlesung/KonferenzTafelbild
01:14:06
MathematikSingularität <Mathematik>VariableKategorie <Mathematik>Ausdruck <Logik>BeweistheorieFunktionalFlächeninhaltZweiVorlesung/Konferenz
01:16:12
Singularität <Mathematik>IntegralAusdruck <Logik>FunktionalGrenzwertberechnungNichtlineares GleichungssystemRandintegralZweiVorlesung/KonferenzTafelbild
01:17:46
GleichungDirichlet-ProblemIntegralGanze FunktionHyperbolischer DifferentialoperatorGrundlösungPoisson-GleichungResultanteTermFlächeninhaltGebietsintegralNichtlineares GleichungssystemAbleitung <Topologie>NormalvektorGammafunktionPunktRandintegralMultiplikationsoperatorRechter WinkelVorlesung/Konferenz
01:22:16
IntegraldarstellungVariableIntegralAusdruck <Logik>FunktionalMultiplikationPoisson-GleichungSkalarfeldFlächeninhaltLinearisierungGebietsintegralNichtlineares GleichungssystemVektorAbleitung <Topologie>NormalvektorPunktGradientRandintegralDifferenteRechenbuchMultiplikationsoperatorStandardabweichungGruppendarstellungVorlesung/Konferenz
01:25:01
Singularität <Mathematik>IntegralGrundlösungAbleitung <Topologie>NormalvektorGradientKonditionszahlRandintegralVorlesung/KonferenzTafelbild
01:26:16
ExistenzaussageFunktionalGrundlösungGammafunktionKonditionszahlVorlesung/Konferenz
01:28:54
GleichungSingularität <Mathematik>IntegraldarstellungIntegralHyperbolischer DifferentialoperatorFunktionalGebiet <Mathematik>Green-FunktionGrundlösungStetige FunktionFlächeninhaltKonstanteNichtlineares GleichungssystemIntegrierbarkeitGruppendarstellungVorlesung/Konferenz
01:30:29
HalbraumFunktion <Mathematik>Beschränktes GebietModulformKategorie <Mathematik>IntegralAusdruck <Logik>Hyperbolischer DifferentialoperatorFunktionalGebiet <Mathematik>Green-FunktionGrundlösungPoisson-GleichungFlächeninhaltNichtlineares GleichungssystemKreisflächeKartesische KoordinatenEliminationsverfahrenAuflösung <Mathematik>Vorlesung/Konferenz
Transkript: Deutsch(automatisch erzeugt)
00:09
So, darf ich dann um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Ganz recht herzlichen Dank. Es geht wieder los mit einer Wiederholung der letzten Stunde
00:21
und ich wiederhole nochmal den Satz, den ich in der letzten Stunde schon wiederholt habe, weil der heute auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Das ist dieser Satz. Ganz hübsch, wenn ich eine Funktion habe, zwar mal diffbar, mit kompakten Träger, also geht irgendwie gegen Null, wenn ich nur weit genug vom Ursprung weg bringe, dann kann ich die Lösung der Laplace-Gleichung hier auf dem ganzen Gebiet,
00:44
auf dem ganzen Raum, deshalb macht es keinen Sinn hier über Randbedingungen zu sprechen, weil der hat keinen Rand, kann ich ausdrücken durch dieses Integral. Insbesondere ist dieses Integral dann wohl definiert und noch viel mehr. Es ist eine zweimal stetig differenzierbare Funktion, die hier rauskommt, stetig diffbar bezüglich x.
01:01
Ich habe hier immer so eine Integration bezüglich y. Und dieses Phi ist die Fundamentallösung. Das heißt, wenn ich f kenne, die Fundamentallösung, Abhängigkeit der Raumdimension, kenne ich e, dann kann ich dieses Integral ausrechnen und habe die Lösung dieser Laplace-Gleichung auf dem ganzen Raum.
01:23
Die Lösung ist falsch, man sieht sofort, naja, wenn ich jetzt auf u noch eine Konstante drauf addiere, die fällt beim zweimaligen Ableiten natürlich weg, löst auch diese Laplace-Gleichung. Also es gibt keine Eindeutigkeit hier, aber ich habe eine Lösung. So, das ist ja sehr schön. Und jetzt auch, da braucht man gar keinen Numerik machen
01:41
oder irgendwie einen Rechner anwerfen und Finite Elemente oder sonst was. Natürlich unglaublich schlimm ist, weil im ganzen Raum, da brauchen Sie immer so ein Finite Element Rechengitter, wie Sie das vielleicht auch schon kennen, haben Sie schon mal irgendwo gesehen, muss man das diskritisieren, dann diskritisieren Sie mal den ganzen Raum. Das ist natürlich eher schlecht. Nein, was brauche ich alles gar nicht, die Analyse, die Mathematik sagt mir,
02:02
ich kann das hier so ausrechnen, indem ich einfach dieses Integral ausrechne. Ja, eigentlich sehr hübsch das Ergebnis. Nur, ich habe schon angedeutet, so eine Parzelliffenzalien, die ist auch eine wichtige Parzelliffenzalien, in vielen Anwendungen taucht die auf, wenn man nicht so Diffusionsprozesse hat oder Wärmeleitprozesse stationär, dann spielt diese Laplace-Gleichung eine Rolle.
02:23
Aber das ist natürlich in vielen Anwendungen überhaupt nicht gegeben, dass ich irgendwas auf den ganzen Raum löse. Ich habe normal eben beschränkte Gebiete, man denke sich irgendwie Wärmeleitungen in irgendeinem Stahlwerkstück oder so was. Also das ist ein Schönheitsfehler bei dem Satz und den wollen wir heute korrigieren. Bevor ich das mache, habe ich mich gestern, letzte Woche allerdings,
02:43
noch so ein bisschen mathematisch ausgetobt und ich habe den Begriff der Distributionen eingeführt. Das sind irgendwelche, das sind wirklich schräge Sachen, das sind jetzt keine normalen Funktionen mehr, das sind Abbildungen, da stecke ich Funktionen rein. Und zwar solche, die unendlich glatt sind mit kompakten Trägern. Also das sind so die schönsten Funktionen, die man sich vorstellen kann.
03:02
Die gehen, wenn es unendlich geht, verschwinden die zu Null und ansonsten sind die unendlich glatt. Die sind unendlich oft differenzierbar. Und so eine Funktion nehme ich und dann mache ich irgendwas mit, dass da eine reelle Zahl rauskommt. Was kann das sein? Ein Integral zum Beispiel. Wenn ich eine Funktion nehme und ich integriere die über irgendwas, dann kommt da eine reelle Zahl raus.
03:21
Ich könnte mir auch nur den Wert an einer bestimmten Stelle nehmen, das wäre dann die Diracche-Delta-Distribution. Wir nehmen aber nicht allgemein alle solche Abbildungen, sondern diese Abbildungen sollen linear sein. Wer nicht mehr weiß, was linearität ist, guckt nochmal nach. Auch die Ingenieure haben das gelernt in ihrer Mathematikvorlesung.
03:40
Das kann man ganz allgemein definieren. So geht das auch für solche Abbildungen. Und die sollen bezüglich von einem komischen Konvergenzbegriff stetig sein. Okay, den Konvergenzbegriff möchte ich jetzt nicht mehr ausführen. Was das ist, definieren kann ich, was ich möchte. Ich fahre mir ein paar Beispiele dazu ein. Ja, zum Beispiel solche regulären Distributionen.
04:00
Ich habe es schon angedeutet, so ein Integral. Ich wende t jetzt an, f soll induzieren, dass es durch die Funktion f gebildet wird, durch so ein Integral, wende ich jetzt an auf eine Funktion phi aus diesem Raum hier, 10, 0, n, t und integriere mit kompakten Trägern. Dann integriere ich das, kommt eine reelle Zahl raus. Also diese Abbildungs-Eigenschaft habe ich schon.
04:20
Man sieht sofort, es ist linear und wir haben gezeigt, dass es auch stetig ist. Natürlich muss f dann bestimmte Eigenschaften erfüllen. Zum Beispiel eine stetige Funktion, das ist dann integrierbar, das geht. Sowas nennt man reguläre Distribution, haben wir letzte Woche gesehen. Eine zweite Distribution, die ein bisschen wilder ist, heißt einfach, nimm diese Funktion und nimm den Wert
04:41
an irgendeiner bestimmten Stelle x. Bei dieser Distribution hier war die Funktion fest, f fest, und hier ist die Stelle x fest. Das könnte zum Beispiel der Ursprung sein. Und diese Distribution, die dann entsteht, das ist auch eine Abbildung, eine beliebige Funktion, und dann nehme ich den Wert dieser Funktion, phi an der Stelle x, das ist also eine Abbildung von diesem Funktionraum hier,
05:01
10, 0, n, t, in den raum der reellen Zahlen. Das ist auch linear und stetig, Hausaufgabe, und das nennt man diraktische Delta-Distribution. Das ist keine reguläre Distribution, mehr kann ich nicht mehr als Integral darstellen. Dann aber ganz wild, als ob die Objekte nicht schon schlimm genug wären, haben wir noch Ableitungen für solche Objekte eingeführt.
05:21
Das ist einfach eine Definition. Wir definieren die Ableitung von so einer Distribution durch diesen Ausdruck hier. Das heißt, ich wende die Distribution auf die Ableitung von phi an. Distributionen sind wohl definiert auf 10, 0, unendlich Funktion. Wenn die 10, 0, unendlich ist, ist die Ableitung auch 10, 0, unendlich.
05:41
Spielt keine Rolle, ob ich die 1000 Mal noch ableite, es bleibt immer unendlich glatt. Und das heißt, ich kann t darauf anwenden. Das haben wir auch gemacht. Und wie sieht das dann zum Beispiel auch hier wieder? Am besten überlegt man sich das dann an Beispielen, was das denn sein könnte. Für diese reguläre Distribution,
06:03
die durch irgendeine Funktion phi gebildet wird, heißt das nichts anderes. Zum Beispiel mal den Laplace hier. D alpha ist halt irgendein Differentialoperator mit Multiindex alpha, könnte halt der Laplace zum Beispiel hinterstecken. Das ist ein Differentialoperator zweiter Ordnung. Das heißt, der Berag von alpha ist 2.
06:23
Und das hier eben genau das Quadrat steht. Und dann wende ich einfach nur die Definition an. Der Laplace von dieser regulären Distribution ist einfach die Distribution angewendet, also mit diesem Vorfaktor, Distribution angewendet auf die entsprechende Ableitung von dem phi. Also die Distribution tf ist einfach Integral f mal Input.
06:43
Und der Input ist jetzt eben die entsprechende Ableitung von dem phi, also Laplace phi. So ist das dann definiert. Definieren kann ich, was ich will. Das soll jetzt die Ableitung der Distribution sein. Wenn man sich jetzt weiter vorstellt, dass f, was wollte ich denn jetzt sagen,
07:02
genau, zweimal stetig differenzierbar ist, dann kann ich hier die zweite grünische Formel anwenden und den Laplace auf das f schiften. Da entstehen Randintegrale, aber die fallen weg, weil das phi auf dem Rand und außerhalb verschwindet.
07:33
Das ist ein Trick, den wir jetzt schon oft gemacht haben. Das ist einfach die Grünformel, die man aus dem Rand integrieren kann. schiefe die Randintegrale in das F. Dann verhaktest du die Randintegrale wieder.
07:40
Und genau dann brushless Schiefe, wie man das jetzt hier anwendet. Ja, so sieht das aus, zweite Gündigformel. Und das kann ich eben machen, wenn f hier so regulär ist. Und was wir dann sehen, ist, dass der Laplace von dieser Distribution gebildet wird als reguläre Distribution mit dem Laplace von f.
08:03
Da kann man irgendwo den Laplace von dieser Distribution mit dem Laplace von der Funktion selber identifizieren. Also ein bisschen schräger Begriff. Wir werden noch nicht groß mit dem Arbeiten, mit dem Begriff der Distribution, lass mal stehen.
08:22
Es ist nur, am Ende führt das auf eine sehr, sehr einfache Formel für diese eigentlich doch sehr unhandliche fundamental Lösung. So, das haben wir also in der letzten Woche gelernt. So, ich hatte letzte Woche, weil vergessen, ich hatte das
08:42
alles schon getecht, aber ich habe vergessen, das entsprechende, den Distributionen Teil als Skript ins Netz zu stellen. Weiß ich nicht, war eigentlich alles fertig. Habe ich nur vergessen, online zu stellen. Entschuldigung dafür, steht jetzt alles online. Und das, was wir heute machen, auch. Das war eigentlich fertig, aber ich habe es halt vergessen,
09:01
ins Netz zu stellen. Genau. Ja, das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Das lasse ich mal weg. Jetzt haben wir diesen Begriff der Distribution eingeführt. Warum haben wir das denn jetzt eigentlich alles gemacht? Was hat jetzt die Distribution mit der Funda mit?
09:24
Ach so, das ist jetzt das andere. Das ist an. So, jetzt bin ich total überfordert. Geil. So, ich mache mal auf Audio. Und jetzt kann ich hier.
09:45
Wird das jetzt lauter? Hallo? Jetzt ist gut, ja. Fiege ich total gut, dass ich das bedienen kann.
10:00
Ist es zu laut? Okay. So, jetzt wollen wir uns mal überlegen. Es dröhnt jetzt aber bei mir so. Egal. Jetzt wollen wir mal überlegen, was die Fundamentallösung jetzt mit diesem komischen Begriff der Distribution zu tun hat. Dafür steige ich wieder in diesen Satz ein. 3.13, super.
10:20
Der hier oben steht. Was ich jetzt machen kann, ist, ich weiß, wenn U dadurch gegeben ist, dann erfüllt U diese diese Laplace-Gleichung. Das heißt, gilt dies Laplace U gleich F. Das kann ich doch jetzt hier oben einsetzen. Da steht ja, das F kommt ja auch in dem Integral vor. Falls daraus folgt,
10:55
Satz 3.13 folgt, kriege ich einmal das Minus da vorne von dem Minus Laplace.
11:04
Steht hier die Fundamentallösung U dy. U von y dy. Und das ist gleich U von x. Ich habe einfach nur die Pde in das Integral eingesetzt. Kann ich ja machen.
11:22
Und das gilt für alle U aus C2 von Rn mit
11:40
Laplace U Element C2 null von Rn. Ja, das ist ja die Voraussetzung. Also, dieses F ist nichts anderes als der Laplace U. Das soll, geschweiger steht, die Tiefbäume, kompakten Träger sein. Und dann kann ich das einfach da oben einsetzen
12:02
und erhalte diese diese Formel für U. Und damit gilt die Formel.
12:20
Warum hat die eigentlich keine Nummer? Das ist schlecht. Ich gebe dir mal eine Nummer. Pseudonummer. Ich nenne die Stern. Damit gilt Stern. Er ist recht. Für alle. Ich nenne das jetzt nicht mehr U, sondern Phi.
12:41
Die Funktion kann ich ja nennen, wie ich will. Ach, nicht Omega. Rn. Ja. Also, überlegen wir uns das mal. Phi soll jetzt C unendlich mit kompakten Träger sein. Das heißt, ich leite das ab, ist immer noch unendlich differenzierbar und so weiter. Das heißt, aus C2 ist es allemal.
13:01
Und auch der Laplace davon, ich verliere, weil es unendlich oft differenzierbar ist. Die Ableitung auch unendlich oft differenzierbar. Die zweite Ableitung auch unendlich oft differenzierbar. Das heißt, der Laplace ist auch unendlich oft differenzierbar. Und die Funktion, die ist irgendwann identisch null. Dann ist auch die Ableitung dort identisch null und die zweite Ableitung auch identisch null. Also auch der Laplace identisch null.
13:21
Das heißt, tatsächlich, wenn das Phi aus C0 unendlich ist, dann ist auch der Laplace Phi da drin. Das heißt, der erfüllt das. Und ich kann, ich kann diese Formel anwenden. Mit x gleich 0.
13:40
Also, ich will das jetzt für einen bestimmten Punkt hier machen. unter der Ausnutzung, dass Phi von x, oder eigentlich muss ich schreiben, ich schreibe mal so, Phi von y gleich Phi von minus y. Warum ist das denn jetzt so? Der, wir haben gesehen,
14:01
die Fundamentallösung ist radialsymmetrisch. Denk nur vom Radius, also vom Betrag von x ab. Und der Betrag von y, oder hier von y, vom Input. Der Betrag von y ist genau derselbe wie der Betrag von von minus y. Da Phi nur
14:20
von Betrag y, schreibe ich das mal hin, Betrag minus y abhängt. Gucken Sie sich nochmal in die Definition von dem Phi rein. Wegen der Radialsymmetrie. Folgt daraus und wenn ich das ausnutze,
14:43
dann folgt das. Integral Rn Phi von y, x war Null. Dann steht Phi von minus y, das ist Phi von y. Laplace
15:01
Phi von y, das ist jetzt diese Zehn-Null-Unendlich-Funktion. Das ist gleich U oder Phi an der Stelle x und x war Null, also Phi von Null. Aber jetzt eben noch mit dem Minus hier. Das ist das Minus. Gleich Minus das.
15:20
So was ist das? Hören wir uns das nochmal an. Das ist noch nichts anderes als Minus Delta-Distribution bezüglich der Null von Phi. Diraktsche Delta von Phi. Wo war das definiert? Gucken wir nochmal hier hin.
15:41
Beispiel für Distributionen haben wir eben gehabt. Die Diraktsche Delta-Distribution Delta von x ist einfach Phi an der Stelle x. Delta von Null, Phi an der Stelle Null. Und das gilt, weil die Formel gilt für alle, für alle U, die das erfüllen. Also ist recht für alle Phi. Damit gilt die Formel auch für alle
16:00
Phi-Element so. Ok, jetzt habe ich das. Und jetzt definiere ich mir die reguläre Distribution,
16:21
die jetzt nicht wie hier mit dem F gebildet wird, mit irgendeiner Funktion F, sondern mit der Fundamentallösung. Also T von Phi. Distribution angewendet auf ein unendlich glatte Testfunktion, kompakt Träger. Folgdefiniert. Phi von ja, da unten, da drüben an der Wiederholung
16:42
habe ich die Integrationsvariable x genannt. Und damit konsistent zu bleiben, nenne ich die jetzt mal y. Phi von y. Wenn ich die Integrationsvariable nenne, ist, ist ja egal. Also eine reguläre,
17:05
reguläre Distribution wird mit dem Integral über Phi definiert. Ist das wohl definiert? Ja, haben wir schon gesehen. Die des unendlich glatt, also insbesondere überall gestränkt. Ist irgendwie kleiner als eine Konstante überall und das Ding ist integrierbar.
17:20
Also ist das, ist das wohl definiert. Das kann ich integrieren. Das ist das Integral. Das haben Sie ja auch in Übungen gemacht, dass die Fundamentallösung integrierbar ist. So, und jetzt schaue ich mir den Laplace davon auf. Also einen distributionellen Laplace. Es ist immer so ein bisschen doof, dass man das mit dem selben Symbol bezeichnet. Hat sich aber so eingebürgert. So, jetzt genau das, was ich hier gemacht habe.
17:42
Distributionelle Ableitung nach Definition ist das das. Hier. Das ist genau diese Definition. Jetzt wende ich das an. Minus eins Quadrat, naja, ist eins, kann ich direkt weglassen. R hoch n. Phi von y, Integrationsvariable hat sich ungenannt.
18:05
Y der y. So. Und das ist ja genau das, was hier steht. Das ist genau dieser Ausdruck. Und da haben wir gesehen, nach der Formel, das ist gleich Delta Null
18:24
von Phi. Und zwar für alle Phi-Elementen C. Das heißt, wir sehen,
18:41
der Laplace von der Distribution, die durch Phi erzeugt wird, der ist genau das Negative der Diraktschen-Delta-Funktion. Das wollen wir nochmal festhalten als Satz.
19:12
Proposition 3.21. Versuchen Sie sich jetzt im Himmelswillen, müssen Sie sich das jetzt nicht anschaulich vorstellen.
19:20
Das ist einfach. Wir haben die Sachen entsprechend definiert, dass sich gerade das ergibt. Was haben wir gesehen? Der distributionelle Laplace. Laplace.
19:44
Der Fundamentallösung. Der Fundamentallösung. Ist, ist die negative
20:04
Distribution in der Null. Das heißt, es gilt. Und das ist jetzt so ein bisschen, der Engländer sagt, Abuse of Notation. Das man einfach so was schreiben. Missbrauch der Notation.
20:21
Aber die Formel ist einfach so schön. Was mit diesem Laplace, Minus Laplace von Phi gemeint ist, ist einfach dieser, ist eigentlich der distributionelle Laplace. Wenn die, wenn Phi, so wie das F hier, regulärer wäre, nämlich C2, was es ja nicht ist, auf dem ganzen Gebiet. Es ist zwar bis auf den Ursprung
20:42
unendlich glatt, aber im Ursprung hat es halt eine Singularität. Wenn es das nicht hätte, dann könnte ich hier wirklich so parzell integrieren, Stichwort zweitegrinische Formel, und könnte den ganzen Laplace auf das F schiften, hätte wieder eine reguläre Distribution. Ich könnte wirklich sagen so, für Mathematiker, Fundamentallämmer, der Variationsrechnung, könnte ich wirklich sagen, ja,
21:01
das, wenn ich hier jetzt noch irgendwie einen Ausdruck hätte, das ist gleich integral über irgendwas von Phi, dann könnte ich wirklich den Laplace von F mit diesem irgendwas identifizieren. Das geht hier aber nicht. Ich kann so das,
21:21
ich kann nicht parzell integrieren. Die Fundamentallösung ist nicht so glatt, die ist nicht C2. Und das sieht man auch, wenn man parzell integrieren könnte, dann würde hier irgendein Integral rauskommen, aber das ist kein Integral mehr. Das ist die Diracche-Delta-Funktion. Keine reguläre Distribution mehr. Das liegt daran, dass diese Fundamentallösung in dem Ursprung eine Singularität hat,
21:42
der in zweiter Ableitung nicht mehr integrierbar ist. Das äußert sich dadurch, dass das eben keine reguläre Distribution mehr ist. Der ist ja dieser Laplace. Ja, und das ist einfach jetzt hier so eine schöne Formel. Ja, ganz hübsch. Also da sieht man so ein bisschen,
22:02
was die Fundamentallösung jetzt mit diesem Begriff der Distribution zu tun hat. Okay. Das ist auch vielleicht so ein bisschen der Gedanke, der hinter der Konstruktion der Fundamentallösung steckt.
22:31
Werden das jetzt nicht mehr weiter brauchen für die Leute, die mit diesem Begriff der Fundamentallösung, der Distribution doch eher so ein bisschen unangenehm fanden.
22:41
Keine Sorge. Es ist nur mal so, dass sie so ein bisschen die Mathematik dahinter sehen. So, das war ja alles ganz hübsch, aber hier steht überall immer Rn. Rn und auch dieser Satz 3.13 war immer auf dem gesamten Raum und das ist eigentlich schlecht, denn,
23:00
wie ich schon mehrfach jetzt angedeutet habe, wir wollen ja irgendwie PDEs, platzierte Verzeichnungen, nicht auf dem ganzen Raum lösen, sondern auf beschränkten Gebieten, irgendwelchen Werkstücken, auf die wir zum Beispiel Temperaturverteilung ausrechnen wollen. Und deswegen müssen wir jetzt diese Analyse, sage ich mal, die wir jetzt betrieben haben,
23:21
für diese Laplace-Gleichung auf dem gesamten Raum oder Poisson-Gleichung auf dem gesamten Raum, müssen wir jetzt modifizieren, adaptieren, für beschränkte Gebiete. Und das führt uns auf die berühmte Green-Schiff-Funktion. Die Green-Schiff-Funktion.
23:40
So, wenn ich jetzt über Gebiete rede, muss ich mir aber zunächst noch irgendwann definieren, was das sein soll. Warum oder welche Anforderungen mein Gebiet erfüllen soll. Ich hatte schon angedeutet, naja, was wir jetzt hier auch da die ganze Zeit an der Ort gemacht haben, den Beweis von dieser Fundamentallösung
24:03
und diesem schönen Satz 3.13 ist partielle Integration. Wir müssen partiell integrieren können. Und genau das dafür, das geht nicht auf jedem Gebiet. Das Gebiet kann dafür Ecken haben, werden wir hier nicht betrachten, aber zu wild dürfen die auch nicht sein. So. Und deswegen möchte ich mal definieren,
24:21
was wir hier für Gebiete betrachten können. Definition 4.1. Ich habe den Begriff eines glatten Gebiet auch schon mehrfach benutzt. Jetzt möchte ich aber auch mal wirklich sagen,
24:40
was das denn sein soll. Das Ganze ist total technisch, aber ich werde Ihnen irgendwie eine Prüfung abfragen, sondern man muss, geometrisch ist das total klar, was man damit meint. Kann man auch sehr schön aufzeichnen. Aber wenn man versucht, das mal in Formeln zu gießen, dann wird das eben sehr, sehr technisch. Ich schreibe das jetzt mal an
25:01
und hinterher mache ich ein paar Zeichnungen und dann wird, glaube ich, allen klar, was gemeint ist. Ein beschränktes Gebiet Rn
25:26
gehört zur Klasse Ck. K, irgendwie eine natürliche Zahl, kann auch die Null sein.
25:42
Man takt, also man teilt die Gebiete in solche Klassen und man, wenn man jetzt ein konkretes Gebiet hat, sagt man auch oft Ck, also C1 Gebiet zum Beispiel, oder C2 Gebiet oder so was. So, wie ist das definiert? So, jetzt wird es kompliziert. Wenn endlich
26:01
viele Koordinatensysteme, wenn endlich viele Koordinatensysteme, die nenne ich, den gebe ich Namen, S1 bis Sm existieren,
26:22
m Element n, natürliche Zahl, und endlich viele Funktionen, Funktionen, die nenne ich
26:41
H1, genauso viele wie Koordinatensysteme, Hm, das sind mal Funktionen, die bilden nicht Rn, sondern Rn-1, weil die leben auf dem Rand. Ich dachte da gleich noch was zu, das würde ich stellen, den Rand da, so wie
27:07
Konstanten a, b größer Null existieren,
27:21
so dass, so dass Folgendes gilt, da gibt es jetzt drei Sachen, die erfüllt sein müssen. Alle Funktionen Hi sind
27:42
auf dem n-dimensionalen Würfel diesen Würfel definiert, Qn-1 nennen wir den, y ist ein Vektor aus Rn-1,
28:03
und der Betrag von y soll gerade kleiner a sein, für alle y, also das wäre, in 2d wäre das ein Würfel,
28:22
hier ist minus a, a, minus a, a, also so ein Quadrat mit Seitenlänge 2a. Und auf diesen Würfeln, wenn das, wenn das n gleich 2 ist, dann ist das einfach nur das Intervall von minus a bis a,
28:41
weil dann ist es hier nur noch eine reelle Zahl, und die Zahl, also i geht dann, ist dann halt nur noch eins, von minus, zwischen minus a und a liegen. Und auf diesen Würfeln soll die Funktion H kann mal stetig diffbar sein,
29:00
bis zum Rand, das bedeutet, die Kartenableitungen lassen sich stetig fortsetzen. Stetig diffbar, ich schreibe einfach mal bis zum Rand. So, also es gibt ja irgendwie, diese Funktionen sind erstmal irgendwie glatt,
29:22
auf so gewissen Würfeln, habe ich hier irgendwie der Seitenlänge a, a ist so eine Konstante, die soll irgendwie nach Voraussetzung existieren, dann habe ich so eine glatte Funktion. Okay, so, was haben die jetzt mit dem Rand zu tun? Habe ich überhaupt noch nicht gesagt. Zu jedem Randpunkt,
29:41
Randpunkt P, also Randpunkt, der liegt auf Gamma, Gamma habe ich noch nicht eingeführt. Das ist schlecht. Da muss ich eine andere Notation nehmen, der Rand hatte ich immer, von Omega hatte ich immer mit d Omega bezeichnet.
30:03
Gibt es ein i zwischen 1 und m, nämlich 1 dieser ganzen Koordinatensysteme mit den ganzen Funktionen S, mit den ganzen Funktionen Hi dort, sodass ich diesen Randpunkt
30:26
in diesem Koordinatensystem darstellen kann. Sodass P im Koordinatensystem Si
30:40
die Darstellung der Punkt P ist irgendwie y h von y mit irgendeinem y aus diesem Quadern da oben.
31:07
So. Und als wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, kommt jetzt noch was, was man kaum versteht, wenn man sich es nicht aufzeichnet,
31:21
im lokalen Koordinatensystem Si gilt,
31:44
wenn y yn in Omega ist. y ist jetzt wieder so ein Vektor wie hier aus Rn minus 1 und ich packe jetzt noch eine Komponente dabei. Also das hier ist irgendwie aus
32:01
Rn minus 1. Das ist aus Rr. Dann kriege ich insgesamt so ein Tupel oder ein Vektor aus Rn. Also irgendein Punkt im Raum. Und dieser Punkt, der soll in Omega liegen. Genau dann, wenn y in Q quer, also im Abschluss dieses Quaders liegt, und es gilt,
32:22
dass Hi von y einer yn kleiner Hi von y. Und jetzt kommt dieses B, das ist diese andere Konstante, deren Existenz sich vorausgesetzt hat. So. Und wenn das nicht in Omega liegt,
32:41
dann folgt daraus y minus B kleiner yn kleiner Hi von y. Das heißt anschaulich, kann man sich überlegen, will ich jetzt gar nicht
33:02
so näher drauf eingehen, dass Omega kann nur einer Seite
33:20
des Randes liegen. So. Eine extrem wüste Definition, die nicht besonders schön ist, aber man kann, am besten macht man sich diese Definition anhand von Beispielen deutlich. Die Beispiele sind bei mir immer zweidimensional,
33:41
aber alles andere kann ich nicht zeichnen. So male ich mal ein Gebiet, wo ich denke, ja, das wird wahrscheinlich glatt sein. Also irgendwie so eine Kartoffel ohne Ecken und Kanten. Oder auch keinen Einschluss und nichts. Das soll wohl irgendwie auch, ich wollte glatte Gebiete definieren,
34:01
das soll wohl in irgendein so ein glattes Gebiet sein. So, wie könnten jetzt diese lokalen Koordinatensysteme aussehen? Die könnten zum Beispiel so aussehen. Das könnte zum Beispiel S1 sein. Von Minus a bis a geht das.
34:20
Und da drauf ist der Rand eine schöne Funktion. Ah, ne, eben nicht hi, sondern h1. Und genau so stelle ich jetzt zum Beispiel diesen Teil des Randes da. Auch hier als Funktion. Er ist jetzt nicht überlappend, das ist ja nicht so schön.
34:43
S2 a minus a und dann habe ich hier schön eine Funktion. Das ist meine Funktion h2. Oder hier oben
35:02
hier von a minus a S3 und das ist meine Funktion h3. Und so weiter. Und so kann ich den ganzen Rand abarbeiten. Und wenn die sich auch noch schön überlappen, alles wunderbar. Und dann sehen wir ja, in jedem dieser lokalen Koordinatensysteme
35:22
habe ich hier so eine Kurve. Und der Rand ist tatsächlich diese Kurve. Das ist dieser Punkt 2. Alle Randpunkte P lassen sich eben so darstellen, dass ich so ein h von y habe. Da fehlt noch was. Da fehlt der Index i hier. Also man sieht,
35:41
in dem lokalen Koordinatensystem, da ist der Rand gerade die Funktion h2. Hier ist die Funktion h1. Hier ist die Funktion h3. Und den 3d, da sind das eben so Koordinatensysteme. Die gehen nicht mehr im Intervall minus a bis a, sondern da habe ich so Quadrate. Und über den Quadraten sind dann so die entsprechenden Randkurven definiert.
36:00
Kann ich natürlich nicht mehr zeichnen. Und ck ist das Ganze jetzt, wenn die ganzen Funktionen h, wenn die alle entsprechend glatt sind. Ja, die sind stetig. Die sind auch differenzierbar in dem, was ich jetzt hier angezeichnet habe. Da sind keine Ecken, keine Kanten. Also ob die jetzt zweimal differenzieren, sehe ich jetzt nicht so, wie ich das gezeichnet habe.
36:20
Aber c1 ist das auf jeden Fall. Das heißt, ich habe hier ein c1-Gebiet. C1-Gebiet. So, jetzt mal ein paar Negativbeispiele. Erstmal ein Gebiet, wo das mit der Glattheit des Randes schaltet.
36:45
Könnte zum Beispiel so aussehen. Omega. Dann habe ich hier so eine nicht differenzierbare Stelle. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel hier mein Koordinatensystem irgendwie reinlege, ach, jetzt habe ich das schon
37:02
gezeichnet, von a, minus a jetzt wieder und gehe da so durch, dann sehen wir ja, ich habe hier eine differenzierbare Stelle. Ja, ich muss das Koordinatensystem ja so nicht machen. Das ist ja auch reichlich ungeschickt. Ich könnte das ja auch anders. Das steht ja nur, irgendwie sollen solche
37:21
Koordinatensysteme existieren, sodass, sodass, gotisch gemalt, sodass dass diese ganzen Sachen hier erfüllt sind. Ja, ist klar. Jetzt auf dem Koordinatensystem habe ich hier natürlich so einen richtig steilen Knick.
37:40
Das ist sicherlich nicht differenzierbar. C1 ist das nicht mehr. C0 ist das natürlich, weil das irgendwie, weil das noch stetig, eine stetige Funktion ist, aber nicht mehr differenzierbar. Ja, die hat da so einen scharfen Knick. Das wäre dann auch ein Beispiel für ein Gebiet, was nicht mal mehr Lipschitzerhand hat, für die Mathematiker. Okay. So, ja, dann
38:01
mache ich doch was anderes. Dann stelle ich mir doch folgendes vor. Ich muss das ja, ich kann mich ja mal geschickt anstellen. Und, ähm, jetzt mache ich den Knick mal anders rum. Das ist jetzt nicht das, woran Sie denken, egal. So. Und dann wähle ich hier einfach zwei Koordinatensysteme.
38:20
Das eine so, minus a bis a. Und das andere wähle ich, ja, analoge. Jetzt kriege ich eh wieder nicht hin, das zu zeichnen. Da ist hier minus a. Und das Koordinaten,
38:40
der Punkt wäre hier a. Dann habe ich hier eine schön glatte Funktion und hier eine schön glatte Funktion. Ja, okay, dass das jetzt keine Funktion ist, sondern hier oben weitergeht, ist erstmal egal. Das heißt, ich habe genau diesen Knick genau an der Schnittstelle zwischen zwei Koordinatensystemen gelegt. Warum ist das dann trotzdem nicht mehr konform mit dieser Definition? Weil diese Dinge offen sind.
39:02
Das heißt, der Punkt P muss sich so darstellen lassen in dem Koordinatensystem mit einem Y aus der offenen Menge. Es kann nicht sein, dass das Y hier genau das a ist, also am Rand meines Quaders, in dem Fall meines Intervalls liegt. Das heißt, und dadurch ist das ausgeschlossen,
39:21
dass ich die genauso scharf aneinander packe. Letztendlich müssen diese Koordinatensysteme sich so ein bisschen überlappen können. Das kann man sich ja hier vorstellen. Mal ich jetzt noch eins dazwischen, kann keiner mehr was sehen. Und dann noch eine andere Funktion, dann sieht man, die überlappen sich so. Und wenn das sein soll, dann kann ich sowas hier nicht mehr verkraften.
39:44
So ein King. So, dass Sie sich so vorstellen können, okay, wenn ich C1-Gebiete habe, keine Ecken. Das ist einfach. Das ist das, was man wollte. Irgendwie fassen, C1-Gebiet, keine Ecken. Wenn man das in Formeln versucht zu fassen, landet man bei so einer
40:00
furchterlichen Definition. So, und jetzt gibt es aber noch einen dritten Punkt. Nämlich diese Geschichte hier der Claderer Dutch. Und da ist ein Gegenbeispiel einfach aufgezeichnet, ein D, so eine Wurst hier. Dann haben wir hier so einen Punkt.
40:21
da stoßen diese beiden Ränder hier von Omega, da stößt der Rand mit sich selber sozusagen zusammen und das geht nicht. Dann kann man sich überlegen, da ist so ein B kann dann an dem Punkt nicht mehr existieren. Und das heißt, Omega liegt jetzt nicht mehr auf einer Seite des Randes.
40:41
Hier ist Omega und auf der anderen Seite ist auch Omega. Das darf nicht sein. Das geht nicht. Ich habe einfach Bedingung 3 verletzt.
41:05
So, also, ehe man sich jetzt irgendwie mit dieser Definition rumplagt, guckt man sich einfach diese Beispiele an und dann weiß man, was damit gemeint ist. Okay, so ist das. Allgemein kann man sagen,
41:21
im Bereich der Patientdefizienz sind diese Gebietsdefinitionen immer mit das Schlimmste, was es gibt. Also, das ist wirklich furchtbar. Es gibt so Jones-Gebiete und Kegelbedingungen und sowas. Und das ist halt immer so anschaulich, grafisch ist klar, was damit gemeint ist. Wenn man versucht, das mathematisch zu fassen,
41:41
landet man bei solchen widerlichen Definitionen. Okay, jetzt wissen wir aber erstmal, was wir hier für Gebiete betrachten. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, was wir immer brauchen, sind C1-Gebiete. Warum C1-Gebiete? Ja, da geht der Satz von Gauss, so wie Sie ihn kennen. Man kann ihn erweitern, das ist auch auf libschelstädigen Gebieten oder, ich glaube,
42:01
libschelstädig brauche ich gar nicht, gilt. Aber damit befassen wir uns hier nicht. Wir setzen C1 voraus. So. Und jetzt wissen wir also, um welche Gebiete es sich geht, zum Beispiel die Kartoffel, die ich da drüben angemalt habe, die geht.
42:24
Und was wir jetzt lösen wollen, oder wir wollen wieder so eine Integraldarstellung herleiten, genau wie die im Satz 3.13, da war es halt nur blöd für den ganzen Raum, und wir wollen jetzt folgende Parzelldifferenzialgleichung betrachten. In Omega
42:40
U gleich G auf Gamma. Das hat jetzt wirklich schon so einen Anwendungshintergrund. Wir haben gesehen, das kann eine stationäre Wärmeleitung sein, Omega ist ein Stück Stahl, den ich da irgendwie aufheizen will. Das sind Quellen, zum Beispiel Mikrowellenstahlungen und am Rand wird die Temperatur irgendwie festgehalten.
43:01
Ist eine idealisierte Randbedingung, aber modifizierte Randbedingungen, die dann wirklich der Realität auch näher ankommen, die kann man auch entsprechend behandeln. So. Und um das zu diskutieren, brauche ich zunächst das wichtige Lemma 4.3.
43:22
Und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich diese Formel, diese Sternchenformel, die gilt für den ganzen Raum und jetzt versuche ich, einen Pendant dazu zu finden, für beschränkte Gebiete. Und was wir sehen werden, ist, dass dieser Term schon auch auftaucht,
43:41
aber es gibt noch Randterme. Also ich brauche erstmal ein C1-Gebiet. Wie gesagt, man denkt immer an diese Kartoffel da drüben.
44:06
Dann gilt für u die beliebige Funktion, zweimal stetig differenzierbar bis zum Rand, also die zweite Ableitung ist die ja stetig zum Rand vorzusetzen. Und für alle
44:22
x Element Omega. Nicht für die Randpunkte, nur für x Element Omega. Die folgende Integraldarstellung.
44:41
u von x ist gleich. Integral über Gamma C1-Gebiet, da sollte ich noch hinschreiben. Hab ich auch im Skript vergessen. Mit Rand Gamma. Ich nenne den Rand manchmal D Omega und manchmal Gamma. Egal.
45:01
So, wie sieht das aus? Ich habe hier einmal wieder diesen Term, den ich hier schon habe, Fundamentallösung, an der Stelle y-x. Jeder ist wahrscheinlich auch falsch, oder? Einen Moment.
45:30
So, nee, nee, ist das schon umgedreht. Ist ja krass. Aber es ist dasselbe, wenn ich jetzt Minus mache, weil die Fundamentallösung asymmetrisch ist. Egal.
45:43
an der Stelle y, dSy Minus Integral über ein Rand u von y d Phi d Nu y minus x auch wieder integriert bezüglich y
46:03
und ein Integral jetzt über das Gebiet Phi von y minus x Laplace u an der Stelle y dY So. So ist das definiert. Und jetzt gucken wir uns vergleichen wir das mal mit Sternchen. Sternchen war auf dem ganzen Raum.
46:20
Auf dem ganzen Raum habe ich keinen Rand. Jetzt mal so Pi mal Daumen Mathematik. Das heißt, die Randintegrale fallen alle raus. Dann habe ich hier nur noch das stehen. Omega ist der ganze Raum, das ist genau die Formel. y minus x ist zwar umgedreht, aber erinnern Sie sich daran, Phi ist radialsymmetrisch, hängt nur vom Betrag ab. Also ist egal, ob ich jetzt hier x minus y habe oder minus x minus x.
46:41
Also sprich y minus x. Ist dasselbe. Das heißt, das, was hier steht, ist genau das Pendant von der Formel für beschränkte Gebiete. Beziehungsweise das ist der Spezialfall davon, wenn Omega gleich Rn ist. Dann habe ich keine Randintegrale. Es gibt keinen Rand. Und übrig bleibt nur dieses Ding mit Omega gleich Rn.
47:01
So, dann sieht man also sofort, dass das wirklich eine Verallgemeinerung ist der Theorie des letzten Abschnitts für beschränkte Gebiete. So, was ist dieses Nu? Nu ist wieder der normalen Vektor,
47:22
habe ich, glaube ich, jetzt schon öfter gehabt. Nu ist der normalen Vektor auf Gamma, auf dem Rand Gamma, die äußeren Normale. So, Beweis. Jetzt muss ich das wieder beweisen, dieses Lemma. Und ich habe schon auf die Ähnlichkeit zu dieser Formel hingedeutet.
47:42
Und das gilt auch für den Beweis. Der Beweis ist nämlich fast genau derselbe wie der von dem Satz 3.13. Es werden dieselben Tricks verwendet.
48:05
Also, ich soll das für jede Funktion beweisen. C2 Omega quer und für jedes x in Omega. Jetzt nehme ich mir mal zwei.
48:21
Beliebiger war fest davon. Beliebig war fest. Muss ich das für ein beliebiges U zeigen. Omega offen ist. Das heißt, der Rand von Omega gehört nicht dazu.
48:42
Ist nur das Innere von meinem Gebiet. Ist b von einer Kugel um x mit Radius Epsilon. Sogar der Abschluss davon in Omega enthalten,
49:00
falls Epsilon größer 0 hinreichend klein ist. So was Ähnliches hatten wir auch schon mal. Stellen Sie sich vor, dass hier ist irgendwie Omega. Dann haben Sie hier ein x. Dann können Sie eine kleine Kugel drum herum legen. Weil das x immer vom Rand entfernt ist. Nichts anderes steht da.
49:21
So, und jetzt erinnern wir uns an den Satz vom Beweis 3.13. Das Problem war, dass die Fundamentallösung so eine Singularität hatte. Und dann muss ich uneigentliche Integrale ausrechnen. Was mache ich dafür? Im Mehrdimensional. Was mache ich dafür? Na ja, ich muss ein bisschen aufpassen bei der Integration.
49:42
Ich schneide erst mal die Kugel raus. Schneide die Kugel raus, wo die Singularität ist. Und genau dasselbe mache ich jetzt hier auch. Gucken wir uns diese Formel mal an hier. So was will ich beweisen. Die Singularität hat das Phi in der Null. Also genau dann, wenn y gleich x ist.
50:01
Und deswegen schneide ich hier von dem Omega diese Kugel raus. Diese Kugel, Epsilon-Kugel um das x. Außerhalb dieses auf V Epsilon ist damit Phi Die Fundamentallösung, unendlich glatt, wohl definiert, keine Singularität mehr.
50:28
Das ist der Rand von V Epsilon. Das ist jetzt der Rand von Omega, Gamma. Vereinigt mit Gamma Epsilon.
50:44
Und dieses Gamma Epsilon ist der Rand von der Kugel. Warum? Weil die Kugel ganz in Omega drin liegt. Gucken wir uns das nochmal an. Wie gesagt, so eine Kartoffel. Jetzt nehme ich hier so ein x, lege ich eine kleine Kugel drumherum. Dann ist das V Epsilon.
51:03
Der Rand von V Epsilon ist einmal dieses Gamma. Und hier dieses Gamma Epsilon. Weil die Kugel komplett da drin liegt, schneidet Gamma Gamma Epsilon nicht.
51:24
Da x nicht in V Epsilon liegt, hier habe ich mir die Kugel gerade rausgeschrieben oben, folgt die Fundamentallösung. Die um x verschobene Fundamentallösung, dieses Ding hier, y minus x, dieses Punkt steht einfach dafür,
51:46
ist unendlich glatt und harmonisch
52:02
für y Element V Epsilon. Weil dieses Ding wird nie Null. Und die Fundamentallösung hat die Singularität in der Null. Daraus folgt also minus Laplace von Phi, y minus x ist gleich Null, für y Element V Epsilon.
52:26
So, außerhalbweise, jetzt muss ich es mal wischen. Mann, ich hänge schon wieder dahinter her. Das ist eigentlich genau dieselbe Argumentation wie beim Beweis von Satz 3.13.
52:43
Ich schneide das wieder weg, was mich stört.
53:35
So habe ich mir dieses V Epsilon definiert. Und das ist sehr schön,
53:42
weil auf V Epsilon ist das Phi unendlich glatt und harmonisch. Und natürlich ist das U sowieso schön zweimal differenzierbar. Das habe ich ja eh vorausgesetzt auf ganz Omega. Also ist es erst recht auf der Teilmenge V Epsilon, C2.
54:01
Das kann man auch mal hinschreiben. Wegen U Element C2 Omega quer. Daraus folgt U Element C2 V Epsilon quer. Das ist ja nun eine Teilmenge. Folgt mit der zweiten griechischen Formel.
54:27
Wieder partielle Integration. Die erste griechische Formel hieß immer, dass ich eine Ableitung drüber shifte. Die zweite heißt, ich shifte zwei Ableitungen rüber. Und das sieht dann so aus. Das ist im Skript in so einem Lemma.
54:43
Stand kurz nach der Definition der Fundamentallösung. Minus Phi von X. Y ist eigentlich egal. Y ist bei Minus X. Laplace U von Y.
55:03
dy ist gleich. Und jetzt kriege ich Randintegrale über den Rand von V Epsilon. Da habe ich schon gesehen. Aha, Rand von V Epsilon. Das ist Außenrand vereinigt mit Gamma Epsilon.
55:25
Dann kommen diese ganzen Randintegrale aus der griechischen Formel.
55:40
Phi von Y Minus X. Und dann die normalen Ableitungen von U. Das ist diese Klammer hier. dy ist einfach nur die zweite griechische Formel.
56:00
Das stand dort mit U und V. Und die Rolle von V spielt jetzt eben Phi von irgendwas Minus X. Okay, zweite griechische Formel. So, daraus folgt. Wegen Laplace Phi Y Minus X gleich Null in V Epsilon.
56:23
Das habe ich dann. Integral Gamma Epsilon. U von Y. Normalen Ableitungen. Phi Y Minus X. dy. Das ist das Integral, das andere Integral.
56:41
Minus Integral. Gamma Epsilon. Phi von Y Minus X. Die normalen Ableitungen von U. dy ist gleich Integral Gamma.
57:01
Phi Y Minus X. du dy. Das habe ich also gemacht. Ich habe dieses Integral über die beiden Randstücke Gamma vereinigt mit Gamma Epsilon aufgespalten. Jeweils ein Integral über Gamma. Und eins über Gamma Epsilon.
57:20
Die von Gamma Epsilon habe ich auf der Seite gelassen. Über Gamma habe ich rübergeschmissen. Gamma. U von Y. Dann kehrt sich hier das Vorzeichen um. Dann kommt hier ein Minus hin. dy. Y Minus X.
57:42
dy. Das sind die Terme. Dann bleibt noch hier der hintere Term. Epsilon. Jetzt kommt dieser ganze Klartat U von Y.
58:02
Nee, kommt ja gar nicht. Richtig. Denn ich weiß ja schon, das habe ich jetzt noch gar nicht ausgenutzt. Phi ist harmonisch hier auf V Epsilon. Das ist gleich Null.
58:21
Das heißt, das Ding, das ist ja hier nur über V Epsilon, ist immer Null. Es bleibt nur noch der Teil darüber. Wenn ich das Minus hier direkt aus dem Integral raussehe. Phi von Y Minus X. Laplace U von Y. dy. So, jetzt vergleichen wir das erst mal. Warum habe ich das alles gemacht mit der griechischen Formel und so weiter.
58:40
Vergleichen wir das mal damit, wo ich hin will. Da habe ich hier zwei Randintegrale und ein Integral über Omega. Und was das selber habe ich hier schon stehen. Die beiden Randintegrale und hier ein Integral über V Epsilon. Das ist ja fast Omega. Ich habe ja nur diese Epsilon-Kugel rausgeschmissen. So, und jetzt hoffe ich, werde ich die richtige Bezeichnung.
59:01
Das nenne ich L Epsilon. Und das nenne ich K Epsilon. So, diese Bezeichnung kommt nicht umsonst. Das sind nämlich genau die Terme L Epsilon und K Epsilon,
59:22
die im Beweis von Satz 3 13 aufgetreten sind.
59:46
Genauso wie im Beweis von Satz 3 13. Da stehen nämlich genau diese Integrale. Nur, dass ich die Notation Gamma Epsilon dort nicht benutzt habe. Das könnte man auch mal vereinheitlich. Sondern ich habe die Notation S Epsilon genutzt. Das war die Sphäre. Allerdings war das um die Null.
01:00:00
Das macht aber nichts, ob das die um die Null ist, die Kugel um die Null oder hier die Kugel um das X. Das ist völlig egal. Sie können maletwegen auch eine Koordinatentransformation machen, das Ganze in die Null schieben. Und dann zeigt man, dass das L-Epsilon, das K-Epsilon, das konvergiert Null, für Epsilon gegen Null, genau wie in dem Beweis.
01:00:38
K-Epsilon ist das. Wir wissen, die Fundamentallösung ist integrierbar, auch über eine kleine Kugel und auch
01:00:49
über die Oberflächen dieser kleinen Kugel, auch wenn die kleine Kugel um die Singularität der Fundamentallösung rumgelegt wird. U ist zweimal stetig differenzierbar, also aus Recht die Ableitung ist auch stetig und die normalen Ableitungen auch.
01:01:03
Das kann ich abschätzen durch eine Konstante nach oben, den Betrag davon auf. Dann zieht man das wieder so auseinander. Ich tue das raus mit dem Supremum, das ist eine Konstante. Dann habe ich hier nur noch ein Integral über eine kleine Oberfläche, über die kleine Kugeloberfläche von der Fundamentallösung, um die Singularität der Fundamentallösung drumrum.
01:01:22
Und da haben Sie in den Übungen gezeigt, das geht gegen Null. Das ist genau wie in dem Beweis von Satz 3.13. Easy. Und was ist damit? Was ist mit dem Integral? Das ist genau wie im Beweis von Satz 3.13. Das Teil verschwindet nicht, aber ich kann zeigen, das war das, was wir auch
01:01:43
gemacht haben, dass das Ding hier genau der Kehrwert des Maßes von Gamma Epsilon ist. Also eins durch Oberflächeninhalt von Gamma Epsilon. Da habe ich hier also stehen. Eins durch Oberflächeninhalt von Gamma Epsilon, Integral U von Y, dS.
01:02:02
Und da haben wir gezeigt, dass das gegen U von X geht. Das ist alles wieder genau wie im Beweis von Satz 3.13. Völlig analog. Schauen Sie da nochmal nach. Es hat nicht umsonst hier diese Ausdrücke gewählt.
01:02:22
Dann habe ich hier noch was. Das nenne ich I Epsilon. Auch wieder ein Beweis von Satz 3.13. Ich glaube, das war ein Beweis von Satz 3.13, nicht I Epsilon. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was die Notation angeht. Das mache ich lieber weg. Kann ich jetzt auch nachgucken, aber ein bisschen umständlich.
01:02:48
So, das spalte ich auf. Da habe ich einmal ein Integral über Omega. Phi von Y minus X, Adent U Y dS Y, Quatsch, dS Y, dY sind Gebietsintegral.
01:03:06
Und, nein, Minus Integral über B X Epsilon, Phi von Y minus X, Laplace U Y dY.
01:03:27
V Epsilon ist ganz Omega und die kleine Kugel ausgeschnitten. Das heißt, das Integral über V Epsilon ist das Integral über Omega minus das Integral über die Kugel. Und das Teil hier, hier steht ja jetzt gar kein Epsilon mehr drin.
01:03:43
Da ist der Grenzübergang gegen Epsilon, ist Lattenwurst, da passiert nichts mehr. Und das konvergiert gegen Null für Epsilon, gegen Unendlich. Auch hier wieder Vergleiche, Beweis von Satz 3.13.
01:04:00
Ja, nochmals Erinnerung, das ist genau wieder wie der Term gegen Null konvergiert. Sie haben hier den Laplace U, U ist C2 auf Omega, das kann ich irgendwie abschätzen durch irgendeine Konstante nach oben. Fertig. Dann habe ich hier nur noch das Integral über diese kleine Kugel von der Fundamentallösung.
01:04:21
Und da haben wir schon gesehen, dass wir das, was Sie in den Hausaufgaben bewiesen haben, kleine Umgebung über die Singularität der Fundamentallösung integriert, mache ich den Radius dieser Kugel, dieser Umgebung gegen Null, verschwindet das Integral. Okay. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an, was ich jetzt hier insgesamt habe.
01:04:43
Das geht gegen Null, das geht gegen U von X, hier steht kein Epsilon mehr drin. Und das geht für Epsilon gegen Null, verschwindet das, geht das da drin. Das heißt, dieser Grenzübergang Y gegen Null liefert das gewünschte Ergebnis.
01:05:19
Ist ja genau das.
01:05:21
Eine Seite konvergiert gegen U von X, die Randintegrale stand sowieso da, und das Integral über V Epsilon konvergiert gegen das über Omega. Okay, was wir wieder ausgenutzt haben, wie im Beweis von Satz 313, diese Eigenschaften der Fundamentallösung. So, was hilft uns jetzt dieses Lämmer?
01:05:49
Na ja, schauen wir uns das doch mal an. Ich habe jetzt dieses Lämmer bewiesen, so eine Integraldarstellung für das U, und jetzt gucken wir, gehen wir mal in die PDE. Was wir schon sehen, wenn ich jetzt sowas ausrechnen will, wenn wir das U von X
01:06:02
als Lösung von der PDE jetzt irgendwie ausrechnen, dann gucke ich mir das hier mal an. Ja, hier steht ja auch U, kenne ich ja nicht, kann ich nicht integrieren, die Fundamentallösung kenne ich, okay. So, jetzt gehen wir nochmal in die PDE. Laplace U ist F, oder Minuslaplace U ist F, das heißt, das hier ist F. Dann habe ich hier schon mal ein Integral, wo ich alles kenne, Fundamentallösung F, bei gegebener rechter Seite F kann ich das integrieren.
01:06:23
Okay, dann weiß ich, U auf dem Rand ist G, das heißt, hier das U kann ich durch G ersetzen, habe ich G, meine normalen Ableitung, Fundamentallösung kann ich auch machen, fertig. Ich auch ausrechnen, okay. Aber hier habe ich die normalen Ableitung von U auf dem Rand, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt irgendwie eliminieren, sonst bringt uns diese Formel gar nichts.
01:06:47
So, habe ich der denn wenigstens einen Namen gegeben? Ja, das war 4,1, das ist gut. Hier, das ist Shit, also Formel 4,1.
01:07:08
Die Idee ist jetzt gleich F und U gleich G auf Gamma in 4,1 einsetzen. So, Punkt.
01:07:26
Dann hätte ich jetzt eine Formel für U, wenn die blöde normalen Ableitung da nicht wäre. Problem, die U den U, unbekannt, kann ich U doch nicht ausrechnen.
01:07:45
Was kann man jetzt machen? Ich muss das Teil irgendwie eliminieren. Lösung, und das mache ich über eine Korrekturfunktion, Phi oben X.
01:08:14
Für jedes X kriege ich eine Korrekturfunktion, Phi X. Und die soll lösen, minus Laplace, Phi von X gleich Null in Omega, die soll also harmonisch sein.
01:08:28
Und Phi von X von Y soll gleich Phi von Y minus X für Y Element Gamma, also auf dem Rand sein.
01:08:46
So was ist das? Das ist also auch wieder eine Lösung der Laplace-Gleichung mit Direktrand-Bedingung. Und als Randdatum nehme ich hier die Fundamentallösung um X verschoben.
01:09:04
Und ich kriege jetzt für jedes X, kriege ich jetzt hier eine unterschiedliche Lösung, Phi von X. Kann ich mir jetzt mal definieren. Definieren kann ich, was ich will. Jetzt habe ich dieses Teil. So, ich schreibe jetzt mal hier weiter. Und mit dem Ding definiere ich mir das, wonach das ganze Kapitel genannt ist.
01:09:32
Definition 4-4 ist das. Die grinsche Funktion.
01:09:54
Dafür muss ich der Gleichung hier erstmal nochmal einen Namen geben.
01:10:05
Also diese Laplace-Gleichung mit diesem inhumogenen Direktrand-Bedingung, wo die Fundamentallösung drin steht, die nenne ich Gleichung 4-5. Ich weiß nicht, ob die eine Lösung hat, keine Ahnung. Ist es eindeutig? Keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Aber ich setze das jetzt mal voraus.
01:10:30
Die Laplace-Gleichung 4-5 besitze für alle X Element Omega.
01:10:44
Also da hängt ja noch X sozusagen als Parameter mit drin. Eine Lösung und nicht irgendeine, die sei auch noch schön regulär. Nämlich C2 Omega quer.
01:11:01
Tätig differenzieren wir bis zum Rand. Man kann ja sowas überhaupt erwarten. Überlegen wir uns das mal, weil wir haben ja hier die Fundamentallösung als Inhumogenität in diesen Direktrand-Bedingungen auf Gamma stecken. Aber X liegt in Omega. Omega ist offen. X liegt also im Inneren des Gebietes, nicht am Rand. Das bedeutet insbesondere, dass Y minus X immer unterschiedlich von Null ist, weil Y liegt auf dem Rand, X liegt nicht auf dem Rand.
01:11:27
Das heißt, die Singularität von dem Phi liegt nicht auf dem Rand. Das explodiert hier also auf dem Rand nicht. Es ist irgendwie eine glatte Funktion, kann sehr groß werden, wenn X jetzt zum Rand hingeht. Wenn es nah am Rand ist, dann wird es sehr groß.
01:11:41
Aber es ist eine glatte Funktion. Das heißt, es gibt zumindest Hoffnung, dass für die X, die im Gebiet drin liegen, dieses Phi von X existiert und auch zweimalstädig differenzierbar ist. Weil die Inhumogenität auf dem Rand als Fundamentallösung dort keine Singularität hat. Okay, das setzt jetzt voraus, dass das lösbar ist.
01:12:06
Wovon hängt das ab, ob das lösbar ist? Das sei auch noch gesagt. Na ja, da steckt jetzt keine unbekannten Funktionen mehr drin. Ich habe als rechte Seite dort die Fundamentallösung und dann natürlich noch das Gebiet. Fundamentallösung ist fest, ist halt irgendwie gegeben. Das heißt, es hängt nur vom Gebiet ab, ob diese Funktion Phi von X wohl definiert ist und zweimalstädig differenzierbar.
01:12:30
Dann heißt die Funktion G, und die bildet ab, Omega Kreuz Omega Quer. Das ist das offene Gebiet und das ist Gebiet plus Rand.
01:12:43
Der Abschluss definiert durch G von X und Y. G von X und Y hängt von zwei Komponenten ab. Das ist einmal diese Fundamentallösung, die jetzt auch in dem Lämmer mit dieser Differenz hier, die auch in dem Lämmer hier andauernd auftauchte.
01:13:08
Und von der ziehe ich jetzt diese Korrekturfunktion ab. X ungleich Y. Sonst hat das Ding irgendwie eine Singularität.
01:13:23
Die heißt Grinsche. Die ist einfach so definiert. Das ist irgendwie C2, glatt, gar kein Problem.
01:13:43
Das hat eine Singularität bei Y gleich X. Also hat auch die Grinsche Funktion eine Singularität bei Y gleich X. Ungleich Y muss man nicht ausschließen. Man muss halt nur wissen, wie die Fundamentallösung explodiert, das Ding da. Und aus so einem Trichter. Okay, das heißt Grinsche Funktion.
01:14:04
So, was hat die jetzt für Eigenschaften? Keine Ahnung. Ich habe jetzt erstmal nur gefordert, dass Phi von X, diese Korrekturfunktion, dass Phi von X erstmal für jedes X wohl definiert ist. Aber wie hängt jetzt dieses Phi von X von der Stelle X ab?
01:14:25
Phi X, nee nicht Phi von X, Phi X ist eine C2 Funktion. Das heißt bezüglich der Variablen Y ist das zweimal stetig differenzierbar. Aber wie hängt jetzt X, wie ändert sich das, wenn ich das X ändere? Ist das dann irgendwie auch noch stetig bezüglich diesem X oder differenzierbar sogar oder was?
01:14:43
Keine Ahnung, lass mal offen. Ich weiß erstmal nur, dieses Phi von X kann ich für jedes X definieren, als Lösung von dieser Laplace Gleichung, vorausgesetzt. Dann kann ich die Grinsche Funktion definieren. Was die für Eigenschaften hat, weiß ich nicht.
01:15:01
Auf jeden Fall haben die eine Singularität, wenn Y gleich X ist. Das ist schon mal klar, weil das Ding da eine Singularität hat. Ich kann auch sagen, was die für Eigenschaften bezüglich Y dann hat, weil ich weiß, das ist C2. Aber was die für Eigenschaften bezüglich X hat, keine Info. Ist aber auch jetzt erstmal nicht so wichtig.
01:15:30
Vorausgesetzt, dass U aus C2 ist und wie ich das dort in der Definition auch gemacht habe, dass diese Korrekturfunktion auch aus C2 ist.
01:15:48
Wenn das vorausgesetzt, kann ich, genau wie ich das in dem Beweis von dem Lemma eben gemacht habe, auch hier die zweite Grinsche Formel anwenden.
01:16:09
Also das ist wieder die Geschichte, wo einmal der Laplace auf der einen Funktion ist und dann auf der anderen Funktion. Und hier stehen diese Randintegrale. Die zweite Grinsche Formel. Dann mache ich das mal.
01:16:20
Und hier muss ich auch nicht mit V Epsilon rumhampeln, weil ich weiß, phi X ist C2. Hat keine Singularität wie die Fundamentale Übung. Dann macht man das. Dann findet man phi X von Y Laplace U von Y zu Y ist gleich.
01:16:42
Dann wird einmal, ich lasse mal das Y jetzt weg, sonst muss ich so viel schreiben. Dann wird einmal der Laplace rübergeschiftet. Aber was passiert ist, das kommt dann zu diesen Randintegralen.
01:17:23
Und jetzt muss ich auch mal irgendwann ausnutzen, wie ich phi von X definiert habe.
01:17:42
Was weiß ich denn über diese Korrekturfunktion phi X? Naja, die löst diese Laplace-Gleichung da drüben. Also Laplace phi X gleich Null. Damit fällt das Integral schon mal weg. Phi X ist in Omega Null.
01:18:02
Was soll denn Null sein? Das kann ich nicht mehr malen. Und dann weiß ich aber noch mehr. Ich habe das so konstruiert, wenn es hoffentlich existiert, dass es diese inhomogenen Dirichlet-Randbedingungen erfüllt. Phi X am Rand ist phi von Y minus X.
01:18:21
Also phi die Fundamentallösung. Hier habe ich die normalen Ableitungen von phi X. Da weiß ich nichts. Aber da kann ich das Ding einsetzen. Das heißt, und das mache ich jetzt auch mal, da steht dann Integral Gamma.
01:18:48
Und jetzt kommt die Fundamentallösung. Phi X auf dem Rand Gamma ist die Fundamentallösung. Aber die um X verschobene Fundamentallösung.
01:19:05
Was ich hier ausgenutzt habe, ist die PDE 45. Was ich jetzt mache, ist... Warum habe ich das jetzt? Wird plötzlich klar, warum ich das alles gemacht habe.
01:19:24
Wenn ich jetzt die Fundamentallösung ausgenutze, diese Gleichung und diese Gleichung addiere... Mal gucken, ob man wirklich addiert. Oder subtraiere ich. Muss man abziehen, oder?
01:19:43
Ja, egal. Ich kann auch die Terme auf eine Seite bringen. Und dann sieht man, da taucht hier einmal dieser Term... Nee, welcher Term hat mich gestört? Der Term auf. Nee, doch addieren, stimmt. Der Term auf. Phi Y, wir sehen es. Und dann diese komischen normalen Ableitungen, über die ich nichts weiß. Da weiß ich gleich F, da weiß ich gleich G.
01:20:02
Das soll die Lösung dieser Laplace-Gleichung sein. Bei dieser Poisson-Gleichung kann ich direkt einsetzen. Da weiß ich nichts. Jetzt habe ich dieses Integral hier. Und jetzt habe ich hier dieses Integral mit Minus. Die heben sich gerade weg. Also folgt... 4 1 plus 4 6 ergibt Folgendes.
01:20:25
Da habe ich da wieder das U von X. Gleich. Das fällt weg mit dem.
01:20:45
Und es bleibt dann hier über einmal dieses Randintegral. Und dieses Randintegral. Also U von Y.
01:21:02
Schreiben wir einmal das Y mit. X. Denü. Ach, ich schreibe das Y nicht mit. Ist mir zu doof. Na doch, ich sollte das mitschreiben. Sonst wird das nicht klar. Denü von Y minus Fundamentallösung.
01:21:25
Denü an der Stelle Y minus X. Die fallen weg. Das ist das Integral. Das ist das Integral mit dem Minus. Das ist Y. Was bleibt noch? Die ganzen Gebietsintegrale.
01:21:41
Da habe ich hier dieses hier auch mit Minus. Und das hier mit Minus auf die andere Seite gebracht. Plus. Also Plusintegral über Omega. Laplace. U von Y.
01:22:00
Phi X von Y. Und dann minus das, was aus 4,1 kommt. Y minus X. Dy. Das bleibt drin. So. Alles sehr schön. Jetzt gucke ich mir an, was ich da stehen habe. Warum habe ich jetzt diese komische grinsche Funktion eigentlich als Differenz definiert?
01:22:22
Weil genau diese Differenzen jetzt hier auftauchen. Beziehungsweise hier das Negative davon. Das ist also gehängt von X und Y ab.
01:22:45
Hier ist die normalen Ableitung. Was ist die normalen Ableitung? Gradient mal normalen Vektor. Gradient mal normalen Vektor ist was Lineares. Das heißt, das hier ist nichts anderes als den nach Denü.
01:23:02
Phi X von Y minus Phi von Y minus X. Und dann habe ich hier genau die grinsche Funktion. Das, was ich hier hingeschrieben habe. Dy. Minus. Und da hinten brauche ich das gar nicht mehr berücksichtigen.
01:23:23
Da steht gar keine Ableitung. Da steht sofort die grinsche Funktion. So. Und wenn ich jetzt noch berücksichtige, dass U am Anfang die Lösung dieser Poisson-Gleichung sein sollte, dann kann ich jetzt die Poisson-Gleichung ausnutzen. Bei diesem Randintegral bin ich auf Gamma.
01:23:42
Da ist das gleich G von Y. Und bei dem Gebietsintegral habe ich den Laplace stehen. Der weiß ich. Der ist F von Y. Und dann habe ich die gewünschte Integraldarstellung. Hier steht U von X. Hier steht irgendwas mit der Randinhomogenität.
01:24:01
Hier steht die Gebietsinhomogenität. Hier steht die grinsche Funktion. Und da der Voraussetzung, dass ich die grinsche Funktion kennen würde, könnte ich jetzt U von X ausrechnen. Ich sollte aber auch noch sagen, hier steht diese nochmal diese normalen Ableitungen. Was ist denn das jetzt hier? Weil G hängt ja nur wirklich von zwei Variablen ab.
01:24:20
Dann muss man sich einfach nur gucken, wie ich da immer diese zweite grinsche Formel der Patientintegration angewendet habe. Dann wird klar, dass diese normalen Ableitung nichts anderes ist als der Gradient der grinschen Funktion bezüglich Y.
01:24:42
Skalar multipliziert mit dem normalen Vektor in Y. Der normalen Vektor hängt natürlich auch von Y ab. Von dem Punkt, wo ich gerade bin. Und Y ist der Punkt, der hier bezüglich dessen dieses Randintegral gebildet wird. Okay. Ja, es wird hier schon wieder ein Gradient von G.
01:25:01
Ist das wohl definiert? Ja, ist der Gradient von G bezüglich Y. Das Ding X ist, ja genau, wir haben hier ein Randintegral. Wenn wir voraussetzen, dass X in Omega liegt, liegt X nicht auf dem Rand. Dadurch hat hier Y läuft hier über den Rand.
01:25:23
Dadurch ist Y minus X immer ungleich Null. Weil X liegt nicht auf dem Rand, Y liegt auf dem Rand. X ist Y minus X immer ungleich Null. Das heißt, diese Fundamentallösung hat nicht ihre Singularität auf dem Rand. Dadurch ist der Gradient auf dem Rand erst mal wohl definiert. Und das Ding war C2 bis einschließlich Rand bezüglich Y.
01:25:43
Für X weiß ich gar nichts. Aber bezüglich Y war das C2. Das heißt, der Gradient von G bezüglich Y, den kann ich wirklich bilden hier. Und dieses Integral, diese normalen Ableitung ist unter dieser Voraussetzung, dass 4,5 wirklich lösbar ist, wohl definiert. Ich kann das erst mal so hinschreiben. Das ist schon mal schön.
01:26:02
Wie der Gradient von G bezüglich X aussieht, keine Ahnung. Damit haben wir jetzt insgesamt folgenden Satz bewiesen. Aber man achte auf die Voraussetzung des Satzes. Genau das, was ich hier bei der Definition vorausgesetzt habe, muss ich jetzt hier auch wieder voraussetzen,
01:26:21
dass diese Korrekturfunktion, die eigentlich diese Laplace-Gleichung löst, dass die erst mal wohl definiert ist. Jetzt schreibe ich genau diese Voraussetzung, die ich bei Definition 4,4 auch geschrieben habe. Für jedes X Element Omega
01:26:49
existiere eine eindeutige, man sollte hier noch schreiben, dass Omega wieder so ein C1-Gebiet sein muss,
01:27:02
weil ich ja das Ganze am Anfang auch schon brauchte. C2 von Omega quer von dieser Laplace-Gleichung für die Korrekturfunktion 4,5. Also also die hier.
01:27:20
Harmonisch und auf dem Rand die Werte der Fundamentallösung. Und wenn ich das fordere, dann ist nach Definition 4,4 die Grinsche Funktion erst mal wohl definiert. So dass definiert ist.
01:27:48
So, und jetzt weitere Voraussetzungen ist auch zweimal, steht ich tippe bis zum Rand,
01:28:01
eine Lösung von u gleich f in Omega u gleich g auf dem Rand.
01:28:24
Dann gilt für alle x Element Omega das, was ich hierhin geschrieben habe. u von x ist Integral Gamma g von y
01:28:43
dg dNu x, y auch hier kommt das Minus noch mit hin. Und hier, das ist nicht gleich f, sondern der Laplace ist Minus f. Minus Laplace u gleich f.
01:29:02
Das ist y, dann wird das hier insgesamt zu einem Plus. Integral Omega f von y g x, y dy. So, das ist Gleichung 4,7. So, damit habe ich hier so schön
01:29:24
eine Lösungsformel. Eine Integraldarstellung für die Lösung. Ist da jetzt alles wohl definiert? Ich habe überhaupt nichts von f und g gefordert. Ja, aber gucke ich mir die Parzeldifferenzial-Gleichung an. Ich weiß, u ist zweimal stetig differenzierbar bis zum Rand. Das heißt, der Laplace ist auch stetig bis zum Rand. Damit sehe ich hier, f muss eine stetige Funktion sein.
01:29:43
Das brauche ich gar nicht. Ich habe das sehr vorausgesetzt, dass u das löst und aus C2 ist. Genau so g, u ist gleich g auf dem Rand. u ist stetig bis zum Rand, also ist g auch eine stetige Funktion. Das ist stetig, das ist stetig. Die grinsche Funktion ist wohl definiert und auch integrierbar.
01:30:02
Haben wir gesehen, da steckt nur Fundamentallösung drin. Die ist integrierbar. Das heißt, das Integral ist wohl definiert und das auch, weil x in Omega liegt, liegt nicht auf dem Rand. Das heißt, die Singularität der Fundamentallösung auch in der Definition der grinschen Funktion liegt nicht auf dem Rand. Damit sind alle Integrale wohl definiert.
01:30:21
Ich kann das erst mal so hinschreiben. Wenn ich die grinsche Funktion kennen würde, für mein Gebiet, die hängt nur vom Gebiet ab, was steckt da drin? Da steckt die Fundamentallösung drin, die ist eh fest. Da steckt diese Korrekturfunktion drin. In dieser Korrekturfunktion steckt keine andere Inhumogenität als selber wieder die Fundamentallösung
01:30:43
und das Gebiet. Das heißt, für ein festes Gebiet ist g fest. Wenn ich das g jetzt kennen würde für irgendein Gebiet, dann könnte ich das entsprechend einsetzen. Dann würde ich hoffentlich die Integrale lösen,
01:31:00
mit Hilfe von Bronnstein, wie auch immer, um ein U ausrechnen. Als Lösung, Poisson-Gleichung auf einem beschränkten Gebiet. Dafür ist das gut. Die Frage ist jetzt, mit der Sie sich gleich in der Übung befassen
01:31:24
und mit der wir uns auch nochmal nächste Woche auseinandersetzen,
01:31:44
wie sieht g für ein gegebenes Gebiet omega aus? Da kann man eigentlich nur Fragezeichen hinmachen. Wenn Sie mir ein Gebiet hinmalen, wie ich eben an der Tafel diese Kartoffel, dann weiß ich nicht, wie die grinsche Funktion aussieht. Das heißt, was wir hier gemacht haben,
01:32:01
ist zum Teil eigentlich nur Probleme verlagert. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben sozusagen durch diese Formel, jetzt mal ein bisschen uns unreinig gesprochen, diese Inhomogenitäten hier eliminiert. Die gehen hier explizit in die Formel ein. Eine PDE lösen muss ich trotzdem noch.
01:32:21
Nämlich diese Korrekturfunktion, wo das Gebiet omega eingeht. Dann kann ich das g ausrechnen. Leider kann man das g so einfach aus dem Ärmel nicht angeben. Aber diese grinsche Funktion, da steckt diese Korrekturfunktion drin, da muss ich selber wieder eine Laplace-Gleichung lösen. Das ist nicht so einfach.
01:32:41
Aber für bestimmte einfache Gebiete kann man das schon. In der Übung gleich machen Sie einen Halbraum. Grinsche Funktion für einen Halbraum. Gut, das ist kein beschränktes Gebiet, aber es hat immerhin einen Rand, nämlich gerade die halbe, zum Beispiel die x-Achse.
01:33:05
Wir machen das in der nächsten Woche für einen Kreis. Grinsche Funktion für einen Kreis. Man kann in der Literatur für einfache Gebiete auch noch grinsche Funktionen nachlesen. Die können oft sehr kompliziert sein. Wenn man sie hat, ist man glücklich.
01:33:20
Dann kann man einfach diese Formen hier anwenden. Wenn nicht, dann hilft die Grinsche Funktion auch nicht so viel. Es sei denn, man ist Mathematiker, man kann aus der Grinsche Funktion einige Eigenschaften der Lösung ableiten über diese Formel. Wenn ich irgendwas weiß, was mein G erfüllt, dann kann ich daraus ableiten, was U erfüllt.
01:33:40
Bis nächste Woche. Geben wir mal ein Beispiel für so eine Grinsche Funktion. Bis dann.
Empfehlungen
Serie mit 4 Medien