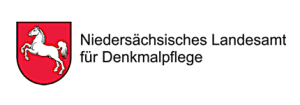Das Braudielenhaus, wie es bis in das 17. Jahrhundert zum Hausbrauen der brauberechtigten Bürger verwendet wurde, ist keineswegs ein auf Einbeck begrenztes Phänomen. Seine Verbreitung erstreckte sich über den gesamten mitteleuropäischen Raum. Als besonderer Bautypus war das Braudielenhaus auch in Goslar vertreten. Am Beispiel der Bier- und Hansestadt Einbeck mit ihren 723 Hausstellen mit Braugerechtigkeit noch im Jahr 1616 wird diese Einwicklung von den Anfängen bis zur Einrichtung fester Brauhäuser beschrieben. Das Braudielenhaus löste seit dem 14. Jahrhundert ältere, mittelalterliche Hausformen wie den Saalgeschossbau und Zwischenformen wie das Vorderhaus mit Kemenate nach und nach ab.
Wie funktionierte dieses Haus, wo wurde das Braumalz gedarrt, wo wurde der Sud gebraut, wo fand die Gärung statt, wo kochte und wohnte die Familie des Brauers? Der Hausbestand in Einbeck mit rund 100 erhaltenen Braudielenhäusern, 50 Dachwerken und 500 Gewölbekellern gibt den Blick frei auf den bürgerlichen Reichtum, bevor die Landesherren und der Dreißigjährige Krieg im 16./17. Jahrhundert diese Phase bürgerlichen Reichtums beendeten. |