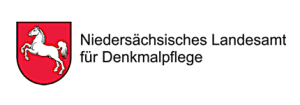Zwischen vielen Fragezeichen. Zum Nordrand der Mittelgebirgszone im 3.–1. Jahrhundert v. Chr.
Formal Metadata
| Title |
| |
| Title of Series | ||
| Number of Parts | 34 | |
| Author | ||
| Contributors | ||
| License | CC Attribution 3.0 Germany: You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor. | |
| Identifiers | 10.5446/57777 (DOI) | |
| Publisher | ||
| Release Date | ||
| Language | ||
| Production Year | 2022 | |
| Production Place | Hannover |
Content Metadata
| Subject Area | ||
| Genre | ||
| Abstract |
| |
| Keywords |